 Vom Popstar zum Schriftsteller
Vom Popstar zum Schriftsteller
– Kaum jemand wird den Songtexten Chico Buarques ihre literarische Qualität absprechen. Aber ist der weltberühmte brasilianische Musiker auch ein passabler Romanautor? Diese Frage wird in Brasilien immer wieder diskutiert. Eine notwendige Diskussion, da dem Autor der strahlende Glanz eines Popstars und Multitalents vorauseilt, was die Kritikfähigkeit des Publikums zu beeinträchtigen scheint. Doris Wieser hat seinen Roman gelesen.
1966 landete Chico Buarque (*1944, Rio de Janeiro) kaum 22-jährig mit „A Banda“ seinen ersten großen Hit. Er wurde zum Teenie-Star, erarbeitete sich aber bald das Image eines veritablen Künstlers, der als Musiker nicht nur Teil an der Erneuerungsbewegung der MPB (Música Popular Brasileira) hatte, sondern auch mit metaphorisch aufgeladenen Lyrics den Finger vorsichtig in die Wunden der Gesellschaft während der Militärdiktatur legte, ohne soweit zu gehen, dabei Haut und Haar zu riskieren. Beispielhaft dafür ist sein Wortspiel im Lied „Cálice“. Die Bitte Jesu an Gottvater „Lass diesen Kelch an mir vorübergehen“ mutiert darin zur Anklage von Zensur und Redeverbot. Ausgesprochen klingen nämlich auf Portugiesisch Kelch („cálice“) und der Imperativ „Schweigen Sie!“ („cale-se“) völlig gleich. Als fast 70-jähriger steht Chico mittlerweile nicht mehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit in punkto Musik. Die Literatur ist ihm in den letzten zwanzig Jahren hingegen immer wichtiger geworden.
Diesen Weg musste er sich jedoch hart erarbeiten. Seine ersten Romane, „Estorvo“ (1991) und „Benjamin“ (1995), gehören nicht gerade zum Kanon der Gegenwartsliteratur. Auch der vielbeachtete Roman „Budapest“ (2003, auf Deutsch bei S. Fischer 2010) beeindruckt wenig. Zu oberflächlich bleibt in der Ausarbeitung die prinzipiell spannende Infragestellung von Autorschaft, die anhand eines Ghostwriters im Spannungsfeld verschiedener Sprachen diskutiert wird.
Vergossene Milch
Doch Chico Buarque wird als Romanautor zweifelsohne immer besser: Protagonist seines aktuellen Romans „Vergossene Milch“ ist der hundertjährige Eulálio, der rückblickend vom Sterbebett aus die Geschichte seiner Familie rekonstruiert. Seine männlichen Vorfahren in väterlicher Linie heißen ebenfalls durch die Bank Eulálio und rühmen sich des aufgrund seiner veralteten Schreibweise aristokratisch anmutenden Familiennamens „Assumpção“ (statt „Assunção“), der wörtlich so viel bedeutet wie „Aufstieg“, beziehungsweise im religiösen Sinn „Himmelfahrt“. Wirtschaftlich und sozial gesehen erzählt der Roman indes gerade vom Gegenteil, nämlich vom Abstieg der Familie. In religiöser Sicht erzählt er von einer bevorstehenden, jedoch äußerst fragwürdigen „Himmelfahrt“ des delirierenden Erzählers.
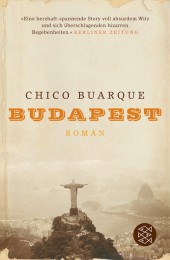 Die Peitsche aus der Alten Welt
Die Peitsche aus der Alten Welt
Der Roman ist geschickt aufgebaut. Seine fragmentarische Zeitstruktur wird durch metaphorische Leitmotive zusammengehalten: eine Peitsche, vergossene (Mutter)Milch und die immer kleiner werdenden Häuser der Familie. Besonders über das Motiv der Peitsche werden gut zweihundert Jahre brasilianischer Geschichte immer wieder punktuell abgerufen, symbolisiert die Peitsche doch das patriarchale und rassistische Kolonialsystem, dessen Nachwirkungen bis in die Gegenwart zu spüren sind. Eulálios Ururgroßvater kam mit dem portugiesischen Königshof 1808 nach Brasilien und brachte die Peitsche mit. Der Urgroßvater – Baron, General und Sklavenhändler – setzte sie im großen Stil während des ersten Kaiserreichs (1822–1840) zur Bestrafung entlaufener Sklaven ein. Eulálios Großvater – Tischgenosse des Kaisers Pedro II (im zweiten Kaiserreich, 1840–1889), Freimaurer und verquerer rassistischer Abolitionist, Kakao- und Kaffeeproduzent – schlägt mit der Peitsche seinen befreiten, aber treuen Sklaven Balbino.
Eulalios Vater jedoch – konservativer Senator während der ersten Republik (1889–1930), außerdem Kaffee- und Waffenhändler – wurde ermordet, ein erstes Indiz für den Niedergang. Eulalio selbst heiratet die Mulattin Matilde, die er immer „weiß redet“, zeugt aber keinen männlichen Nachkommen. Die Firma des Vaters kann er nicht über die Weltwirtschaftskrise, den Zweiten Weltkrieg und das autoritäre Getúlio Vargas-Regime (1930–45 und 1951–54) hinwegretten. Seine Tochter Maria Eulália bekommt zwar wieder einen Sohn, der natürlich auf den Namen Eulálio getauft wird und abermals Vater eines Eulálios wird, doch die jüngeren Eulálios entsprechen nicht dem patriarchalen, konservativen Ideal des Mannes. Unter ihnen tummeln sich Kommunisten, Mulatten, Drogendealer. Die weiße Herrschaft ist gebrochen. Der Untergang der „Dynastie“ absehbar.
Ideenreichtum oder Abklatsch?
Trotz seines Ideenreichtums und handwerklichen Geschicks muss sich Chico Buarque immer wieder vor der Kritik behaupten. In der symptomatischen Rezension von Júlio Pimentel Pinto wird den Medien vorgeworfen, Chicos Werk praktisch kritikfrei zu behandeln und ungebührlich zu loben, aufgrund der Vorschusslorbeeren, die er als Sänger erworben hat. Der Rezensent ruft gleichsam zu einem kritischeren und informierteren Umgang mit „Vergossene Milch“ auf. Dazu seien allerdings Leser nötig, die mehr als einen Roman im Jahr lesen und über zahlreiche Referenzpunkte verfügen – eine Art von Leser, die in Brasilien nicht so häufig zu finden ist. Denn der Hauptvorwurf Pimentel Pintos lautet: Chicos Buch ist ein minderwertiger Abklatsch anderer zeitgenössischer sowie bereits kanonisierter Werke. Die Idee, einen Sterbenden vom Krankenbett aus monologisch sein Leben Revue passieren zu lassen, hatten außer ihm noch Philip Roth in „Empörung“ (2009), Carlos Fuentes in „Der Tod des Artemio Cruz“ (1962), und natürlich erinnert dies auch an die „Nachträglichen Memoiren des Bras Cubas“ (1880) von Brasiliens Altmeister Machado de Assis, in denen der Protagonist sein Leben aus dem Jenseits schildert.
Damit hat Pimentel Pinto zweifelsohne Recht. Geübtere Leser werden bei diesem Roman auf Schritt und Tritt das Gefühl haben, das alles schon zu kennen. Die Technik des Monologs eines alten oder in irgendeiner Hinsicht totgeweihten oder desillusionierten Ich, das sich an einen stummen Gesprächspartner wendet, kennt man auch von Gegenwartsautoren wie Horacio Castellanos Moya (El Salvador) oder Ignacio Solares (Mexiko). Da es sich dabei um ein ziemlich auffälliges erzählerisches Mittel handelt, sind Schriftsteller gut beraten, vorsichtig damit umzugehen. Denn, was den Lesern besonders ins Auge sticht, läuft Gefahr, spätestens bei der dritten Wiederholung abgenutzt zu wirken.
Dennoch, Chico Buarque zaubert – obwohl er mächtig abgekupfert hat – aus einer bekannten Idee ein erstaunliches kleines, absolut lesenswertes Büchlein, das beim genaueren Hinschauen die Kreativität des Autors in Sachen subtiler Gesellschaftsanalyse unter Beweis stellt. So schlägt er einen Bogen über zwei Jahrhunderte brasilianischer Geschichte, ohne diese im eigentlichen Sinne nachzuerzählen. Es ist vielmehr eine Reihe von symbolischen und metaphorischen Elementen, mit denen er gesellschaftliche Praktiken evoziert und mit dezenter Ironie verzerrt. Damit zeigt er, wie das kulturelle Erbe der Sklavenhaltergesellschaft (Patriarchat, Rassismus, Sexismus, soziale Ungerechtigkeit) sich schleichend und unabwendbar in den zwischenmenschlichen Beziehungen bis heute fortsetzt.
Doris Wieser
Chico Buarque: Vergossene Milch (Leite derramado, 2009). Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Karin von Schweder-Schreiner. S. Fischer 2013. 208 Seiten. 19,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.











