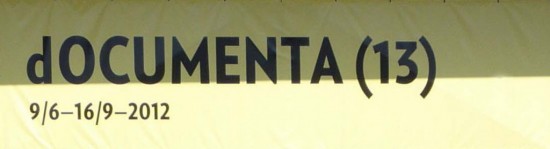„Ich bin ein gescheiterter Künstler“
„Ich bin ein gescheiterter Künstler“
– Was verstehen wir unter „Kunst“, was unter „Künstler“? Für die bildende Kunst keine Frage, ihre Angehörige sehen in den Begriffen sich selbst und definieren ihren Status über ihre Nähe zu den Geldtöpfen des Markts. Wer dort nicht rankommt, ist kein Künstler. Oder – noch schlimmer – er ist ein gescheiterter Künstler. Davon handelt der Roman von Christian Saehrendt. Brigitte Helbling hat ihn gelesen.
Ich kannte mal jemanden, der jemanden kannte, der sich Anfang der 1990er an der Kunsthochschule in Hamburg mit Jonathan Meese und weiteren Studenten ein Atelier teilte. Die Geschichte ging dann so, dass Meeses Schaffenswut die Atelierkollegen innert kürzester Zeit verdrängt habe, so dass die in einer Ecke unbeachtet vor sich hinwerkelten, während der Bärenmann Wände, Decken und Fußboden mit seiner Kunst überzog. Nicht anders kommt es den „Verlierern“ im Kunstmarkt zweifellos heute noch vor, die im Gegensatz zu Meese keinen Sammler, keinen Galeristen, keine Öffentlichkeit für ihre Werke gefunden haben. Aus Sicht des Laien gleicht die Welt der bildenden Kunst einer Reise nach Jerusalem – Tausende wollen mitspielen, aber am Ende, das erfordert auch das Marktkalkül, sind immer nur fünf Stühle frei.
Er habe die „Schwarzmalerei“ aufgegeben und sei stattdessen „Produzent heiterer Literatur“ geworden, sagt der ehemalige HfbK-Student Christian Saehrendt in einem Vortrag vor dem Schweizer Berufsverband der bildenden Kunst in Thun. Auch Saehrendt war einst ein Kommilitone von Meese (ob er mit ihm das Atelier teilte, wissen wir nicht). Er ist (unter anderem) der Verfasser des Romans „Die radikale Absenz des Ronny Läpplinger“, der von Ronny Läpplinger, ein weiterer Kommilitone Jonathan Meeses, erzählt. Zum Zeitpunkt der Handlung hat es Läpplinger nach Beendung des Studiums in Hamburg und weiteren Zwischenstationen nach Böblingen (zurück) verschlagen, wo er im Haus seiner Mutter sitzt, über den endgültigen Durchbruch nachdenkt und dabei immer mehr den Boden unter den Füßen verliert. Heiter ist das Werk vielleicht nicht gerade – Läpplinger verkommt auf die denkbar uninspirierteste (Frauen, Alkohol, Drogen) Art und liegt am Ende, nach einer missglückten Aktion an der Documenta (13) (die in Kassel erst noch stattfinden wird), im Koma. Informativ ist die Lektüre aber auf jeden Fall – und nicht nur für diejenigen, die das Insiderwissen zur Kunstszene haben.
Wenn Meese für den kreativen Überfluss steht, dann ist Läpplinger das Gegenteil, ein Verweigerer, der sich einst an Kunstschulen mit einer Mappe mit „leeren Blättern, leeren Videotapes und komplett überbelichteten Fotos“ bewarb (einzig Hamburg war bereit, ihn aufzunehmen), und im Studium hauptsächlich durch ein Nichts-Tun auffiel. Als er dann doch anfängt zu malen, versteht er die Geste als ironischer Akt. Die Bilder im „provinzsurrealistischen“ Stil finden beim (Klein)bürgertum jedoch Anklang, bald übernimmt er unter seinem Pseudonym RON.EGOXL auch Portraitaufträge, bemalt Restaurantwände, findet darüber sein Einkommen und gewöhnt sich zunehmend an den Verdienst.
„Die radikale Absenz des Ronny Läpplinger“ beschreibt im Tagebuch der letzten 18 Monate vor dem Documenta-Debakel Läpplingers Versuch, von der Kitschschiene weg und auf den Highway der hohen Kunst zurückzukehren. Herausgegeben wird es von seinem Ex-Kommilitonen Christian Saehrendt, ergänzt wird es durch Text-Kommentare derjenigen, die in Läpplingers Einträgen auftauchen. Der Versuch, Läpplinger als „reale“ Figur zu etablieren, wird eher halbherzig durchgezogen, die im Text vierfarbig reproduzierten Bilder, die „Ronny“ in dieser Zeit malt (Selbstportraits, Familienportraits, Unternehmerportraits) sind in den Anmerkungen zu den Autoren hinten im Buch als Werk des Schweizer Künstlers und Comic-Zeichners Noyau ausgewiesen, den man vom Typ her geradezu als das Gegenteil von Läpplinger bezeichnen könnte (und dem dieser „Fälscherauftrag“ bestimmt Spaß gemacht hat)
„Ich bin ein gescheiterter Künstler“ sagt Christian Saehrendt, der Schriftsteller, in dem oben erwähnten Vortrag. Für die bildende Kunst gibt es nur eine Art „Künstler“, und die wiederum behalten den Blick starr, Maus-vor-der-Schlange-gleich, auf Kollegen und Markt gerichtet. Arme Kunstschaffende. Das gilt selbst für das Manifest der Verweigerung, das Ronny Läpplinger gegen Ende schreibt, um es bei der Documenta (13) als Flugblätter abzuwerfen. Wer sonst außer die Mitspieler im Kunstbetrieb interessiert sich für Sätze wie: „Kunst ist kein Spekulationsobjekt… Kunst ist kein Schmiermittel für Wirtschaft, Gesellschaft und Werbung… Verweigert euch! Entzieht euch dem Hype!“? Die Szene redet mit sich selbst. Außerhalb gibt es nichts als leeren Raum. Dieser interne Sumpf aus Diskursblasen ist der Gegenstand dieses Romans, der damit seine eigene Absenz oder Leerstelle gleich mitschreibt. Was hier fehlt (und zwangsläufig fehlen muss), ist die Erfahrung von Kunst, die den Produzenten transzendiert – so dass man endlich nicht mehr ihn, sondern nur noch das hört, was das Werk uns allenfalls zu sagen hat.
Brigitte Helbling
Christian Saehrendt: Die radikale Absenz des Ronny Läpplinger. Mit Illustrationen von Noyau. Walde + Graf. Zürich 2011. 270 Seiten. 19.95 Euro.