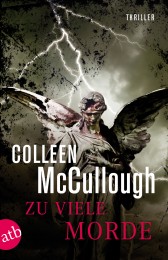 Nekrophil, sadistisch, Fastfood …
Nekrophil, sadistisch, Fastfood …
„Die Dornenvögel“ war mal ein Weltbestseller von Colleen McCullough. Das ist lange her und inzwischen hat die australische Autorin eine Menge andere Romane geschrieben, eine Serie über die alten Römer und ein paar Cop-Novels. Literarische Aufmerksamkeit hat sie damit nicht unbedingt erregt. Warum auch, fragt sich angesichts von „Zu viele Morde“ Anne Kuhlmeyer.
Zwölf Leichen an einem Tag, dem 3. April 1967, die alle auf unterschiedliche Weise ums Leben kamen, sind definitiv zu viele für eine amerikanische Kleinstadt. Und für den Leser auch. Denn sie haben Verwandte und Ermittler, die auch Verwandte haben, alle haben Namen, Zweitnamen, Spitznamen, Titel, Wohnorte und Geschichten. Nach etwa 100 Seiten lichtet sich das Ganze etwas, als sich herausstellt, dass Skeps, der als Vorstand eines der größten amerikanischen Rüstungsunternehmens leitet und vor seinem Tod grausam gequält wurde, das eigentliche Ziel der Gewaltorgie gewesen sein könnte. Zu diesem Zeitpunkt sind nur noch elf Morde ungeklärt. Ein behinderter Junge wurde von seinem Bruder mit einem Kissen erstickt. Captain Carmine Delmonico und sein Team sieht sich der schier unüberwindlichen Aufgabe gegenüber, die ermittlungsrelevanten Daten zeitnah zusammenzutragen. Ein FBI-Mann kommt Carmine in die Quere, mit dem er sich fröhlich prügelt – eine schroffe Männerfreundschaft beginnt. Der FBI-Mann und Carmine gehen davon aus, dass es sich um einen Täter bzw. einen Organisator der Verbrechen handelt, „Odysseus“ beim FBI, „das Superhirn“ bei der Polizei genannt. Haben wir es mit mutmaßlicher Spionage im Kalten Krieg zu tun? Carmines alter Freund Myron, der Filmproduzent und ehelicher Nachfolger bei seiner Ex-Frau ist, hat sich abgrundtief in die eisgekühlte, machtmotivierte Erbin des Vorstandspostens verliebt. Praktischerweise entgeht er den Folgen, denn …
Bösewichter führen Protokoll …
Ich will nicht vorgreifen. Myron ist ein ganz ein Guter und schützt die bezaubernde Familie Carmines, nachdem die Tochter, später seine junge Frau mit Sohn im Säuglingsalter, in Gefahr gerieten. Warum ihnen das widerfährt, weiß kein Mensch. Die Nebenhandlung endet wenig überzeugend. Auch Carmine ist ein wirklich anständiger Kerl mit einem klugen Kopf, einer attraktiven Erscheinung und einer gehörigen Portion Gerechtigkeitssinn. Er lässt sich weder von den College-Seilschaften täuschen, noch von den verrückten oder gerissenen Ehefrauen einiger Opfer. Selbstverständlich kommt er mit seinem begnadeten Team dem Bösewicht auf die Schliche. Und ordentlich, wie so Bösewichter nun mal sind, protokollieren sie ihr gesamtes Bösesein akribisch in Tagbuchaufzeichnungen, die aus 007-mäßigen Verstecken geangelt werden und Carmine als Grundlage dienen, dem Schlimmling moralische Vorhaltungen zu machen. Bevor es soweit ist, bekommen wir es mit Massenvergewaltigung, Giftmorden, Auftragskillern, sadistischen und nekrophilen Neigungen und jeder Menge Familiengeschichten zu tun.
Warum nur, warum?
Bis zum Schluss bleibt mir verborgen, wozu das alles gut sein soll. Ja, es gab und gibt Spionage. Ja, es gab und gibt Verflechtungen der Wirtschaft mit Interessen von Regierungen und deren Ideologien. Und es gibt Leute, die für Macht und Geld über Leichen gehen. Das war 1967 nicht anders als heute. Weshalb dann ist der Roman 1967 angesiedelt, ohne neue Haltungen zu beziehen, ungewöhnliche Blickwinkel einzunehmen oder auf irgendeine Weise ins Jetzt zu reichen? Sicher, es gibt einen rund herum schlüssigen Plot, eine handwerklich geschickte Dramaturgie, die Figuren sind in sich glaubwürdig gestaltet und es wird, wie nicht anders zu erwarten, in einem soliden Stil erzählt, alles garantiert komikfrei. Nur interessiert mich die ganze Angelegenheit wenig, und so lässt mich der Roman an seinem Ende wie der Besuch eines Fast-Food-Restaurants mit einem Schulterzucken zurück.
Anne Kuhlmeyer
Colleen McCullough: Zu viele Morde (Too many murders, 2009). Roman. Deutsch von Jürgen Bürger und Kathrin Bielfeld. Berlin: Aufbau 2012. 420 Seiten. 10,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.











