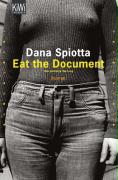 Letzte Ausfahrt Seattle
Letzte Ausfahrt Seattle
In ihrem Roman Eat the Document versucht Dana Spiotta, den Widerstand der Sechziger mit dem Aufbegehren der Globalisierungskritiker zu verschränken, bleibt aber in einem glatten Oberflächenrealismus stecken, der kein widerständiges Bewusstsein zu entwickeln vermag. Von Jörg Auberg
Lange war der einheimische Terrorismus, der sich aus dem studentischen Widerstand gegen den Vietnamkrieg Ende der sechziger Jahre entwickelte, in der zeitgenössischen US-amerikanischen Literatur kein Thema. Marge Piercys Roman Vida (1979) über eine untergetauchte Antikriegsaktivistin, die sich in einem Netzwerk klandestiner Gruppen aus der Konkursmasse der Neuen Linken bewegt, gehört zu den raren Beispielen wie auch Paul Austers Roman Leviathan (1992), in dem der ehemalige Schriftsteller Benjamin Sachs als „Phantom der Freiheit“ individualistische Bombenattentate verübt, um das Land aus der Apathie zu reißen.
Rebellion im Retro-Szenario
Ironischerweise hatte das Thema des linken „native terrorism“ erst Jahrzehnte nach dem Ende des „Guerillakriegs in Amerika“ (wie der Journalist Warren Hinckle das Phänomen Anfang der 1970er-Jahre in einem umfänglichen Report für das investigative Magazin „Scanlan’s“ beschrieb) und in der Hochzeit des „Krieges gegen den Terror“ Konjunktur. Als Dana Spiottas Roman Eat the Document im Jahre 2006 für den National Book Award nominiert wurde, gehörte sie bereits in die Phalanx jüngerer Autoren, die die Geschichte des amerikanischen Terrorismus’ weniger als politisches denn als kulturelles Phänomen aufbereiteten. Der Extremismus der 1970er-Jahre gehört in diesen Retro-Bearbeitungen zum popkulturellen Erbe Amerikas, das die eigenen utopischen Versprechen nicht einlösen konnte.
Spiottas Protagonistin Mary Whittacker (die unter den falschen Identitäten Caroline Sherman und Louise Barrot in den USA eine klandestine Existenz führt) ist nach der realen Aktivistin Katherine Ann Power modelliert, die nach einem Banküberfall, bei dem ein Polizist getötet wurde, 1970 in den Untergrund abtauchte und sich nach 23 Jahren den Behörden stellte. In Spiottas Roman ist Mary zusammen mit ihrem Freund, dem Underground-Filmemacher Bobby DeSoto, in der Antikriegsbewegung aktiv. Sie begreifen sich als Privilegierte, deren moralische Pflicht es ist, etwas gegen den unmoralischen Krieg zu tun, wie unvollkommen es auch sein mag. Sie müssen zurückschlagen oder sie würden ihr Leben lang eine Schande fühlen. Als bei einem Bombenattentat eine Unschuldige getötet wird, beginnt eine Flucht, die in den späten 1990er-Jahren im amerikanischen Suburbia endet. Marys halbwüchsiger Sohn Jason deckt schließlich die Vergangenheit seiner Mutter auf: „Sie ist eine Revolutionärin“, schreibt er in sein Tagebuch. „Sie ist auf der Fahndungsliste. Sie ist eine Lügnerin. Sie ist eine Mörderin.“
Bobby führt – unter dem Namen Nash – einen Buchladen namens „Prairie Fire“ in Seattle, der ein Treffpunkt für junge Globalisierungskritiker und andere Polit-Aktivisten der Internet-Generation ist, die trotz aller guten Argumente gegen die herrschende Kultur und wegen ihres unterschwelligen Zynismus’ anfällig für die Korrumpierung durch das „System“ ist: Der temporäre Angriff endet mit der Integration des Angreifers im System des Angegriffenen. In die zur Schau gestellte Rebellion ist die Komplizität mit dem Bestehenden eingebaut. Leichter als die ältere Generation versumpft die neue Generation ohne es recht zu bemerken. Vom Leben auf der Flucht gezeichnet, treffen sich dagegen Mary und Bobby nach 28 Jahren noch einmal kurz, ehe sie sich den Behörden ausliefern und die Konsequenzen für ihren „Riesenfehler“ auf sich nehmen.
Diffuse Projektionen
Während Mary verzweifelt unterstreicht, man dürfe ihre Taten „nicht ohne Kontext betrachten“, lässt Spiotta den politischen Kontext außen vor: Die Akteure agieren zwar in einem Raum des Widerstands gegen den Vietnamkrieg, doch Organisationen und politische Formationen kommen in dieser Rückprojektion nicht vor. Alles wird auf die „Verzweiflungstat“ reduziert. Während die politischen Hintergründe und Bedingungen für den Weg in den Untergrund verschwimmen, fokussiert Spiotta ihr Interesse auf den „sozialen/kulturellen/historischen Kontext“, wie sie in einem Interview ausführte. Detailliert, aber auch mit einem nostalgischen Faible bildet sie im Stile Don DeLillos kühl und matt die kulturelle Oberfläche der 1970er-Jahre mit Fragmenten aus TV-Serien, Mode, Magazinen und der Underground-Presse nach, sodass zwar in der pastichehaften Szenerie die „Weather-Underground-Sirene“ Bernardine Dohrn als Popikone in Lederminirock und kniehohen Stiefeln auftaucht, aber der politische Kontext bleibt – ungeachtet Spiottas Interesse an der amerikanischen Tradition des Widerstands und der Rebellion von den Sozialisten und Wobblies bis zu den heutigen Tech-Hippies – vollkommen unterbelichtet.
Die Beweggründe, warum die Protagonisten zum Mittel der tödlichen Gewalt als Ausdruck des Protests gegen den als verbrecherisch wahrgenommenen Vietnamkrieg griffen, bleiben diffus, und der Roman verharrt in einer trägen Ambiguität. Politik wird ausschließlich auf der Ebene der Emotionalität, eines vagen Idealismus und Zorns begriffen, die über eine längere Periode nicht konserviert werden können, sodass sich Geschichte stets nur in einer Folge kurzer Schübe kommender und vergehender Generationen artikulieren kann. Spiotta begreift den Roman als eine „authentische Befragung des menschlichen Herzens“ und ein „wahrhaft subversives Medium“ gegen die „seichte, reduktionistische, simplizistische Tendenz in der Kultur“, vermag ihrer Konstruktion jedoch keine politische Stimmigkeit und Kohärenz zu verleihen, sodass der Roman einerseits die Spuren einer gehetzten, identitätszerstörenden Untergrundexistenz in Einzelfiguren nachzeichnet, andererseits aber kaum den gesellschaftlich-historischen Raum der Aktivisten ausleuchtet.
Steriler Oberflächenrealismus
Spiotta insistiert zwar, dass man auf die Rebellionsversuche früherer Generationen ohne Klischee und Nostalgie blicken müsse, doch sie selbst läuft in die Falle der nostalgischen, sentimentalen Verklärung einer industriellen Massenkultur (deren Protagonisten die Beach Boys, Grateful Dead oder Creedence Clearwater Revival sind), die das Bewusstsein überwuchert. In der realistischen Nachbildung der Ereignisse verschwinden politische Ideen hinter den Bilder- und Tonwelten einer konformistischen Kultur, in der für eine „radikale Kritik des Bewusstseins“ (wie Susan Sontag sie noch 1967 als Gegenentwurf zum Bestehenden beschwor) kein Platz mehr ist. Der Roman verliert sich in einer bruchlos inszenierten Gefälligkeit, wo alles zur rechten Zeit am richtigen Ort scheint, doch fehlt der Erzählung in ihrer Konstruktion die Stimmigkeit. Alles ist in einem sterilen Oberflächenrealismus angeordnet, an dem schließlich die behauptete Kritik des Konformismus der gegenwärtigen Zustände abprallt. Auch der Roman fügt sich nahtlos in die bestehende Kultur ein, da ihm das Bewusstsein der Subversion fehlt, das sich in einer sperrigen Sprache ausdrücken könnte. Er ist selbst Teil der Zustände, die er zu attackieren vorgibt.
Jörg Auberg
Dana Spiotta: Eat the Document – Die perfekte Tarnung. (Eat the Document, 2006). Übersetzt von Hannes Meyer. Kiepenheuer & Witsch 2008. 351 Seiten. 9,95 Euro.











