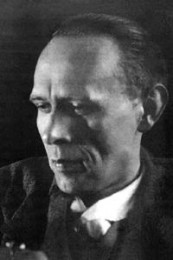 Charms in translation
Charms in translation
– Eigentlich darf ich diese Rezension gar nicht schreiben. Daher höre ich damit auf. Tschüss … Andererseits ist es genau der Grund, weshalb ich nicht schreiben darf, der mich dazu bringt, weiterzumachen. Von Vladimir Alexeev
Eine Werkausgabe von Daniil Charms im Buchladen zu entdecken, ist immer ein großartiges Gefühl. Charms ist ein Grund zum Feiern. Als ich dann noch erfahre, dass es sich um eine Neuübersetzung handelt, bin ich besonders gespannt – und wundere mich. Denn eine Neuübersetzung ist vor allem dann besonders wichtig, wenn die alte Übersetzung nicht mehr frisch und modern ist. Doch genau deswegen stellt sich die Frage, wieso man Charms neu ins Deutsche überträgt, wo es doch die Übersetzungen von Peter Urban gibt? Die sind frisch, die sind modern, die sind fundiert und literarisch hochwertig – besonders, wenn man die Übersetzung mit dem Original vergleicht.
Und so öffne ich die neue Ausgabe der Galiani-Edition – und erkenne erst einmal, dass ich – als ein Literaturwissenschaftler – nicht rein darf. Es wird mir sozusagen explizit der Zugang verwehrt. Denn im Nachwort des Herausgebers und Übersetzers Alexander Nitzberg lese ich folgende, in sich unschlüssige Schlussfolgerung: „Die Rede ist davon, wie eine derart bunte und in kein Raster passende Persönlichkeit im Laufe der Jahre zu einer in universitäres Formalin eingelegten Spezies werden konnte, die nur noch mit Hilfe von philologischen Spektralanalysen und durch lexikalische Mikroskope zu beschauen ist! Aber Charms ist kein literaturhistorischer Diskurs, kein intertextuelles Glasperlenspiel für Eingeweihte. Trotz seiner enormen Belesenheit und des Hangs zum Klassifizieren lag ihm jeglicher Akademismus vollkommen fern!“
Diese ständigen Seitenhiebe auf das Akademische ziehen sich durch das gesamte Nachwort, so dass der Eindruck entsteht, Universitäten seien nur damit befasst, Charms’ sprudelndes Chaos in spanische Stiefel einzuschnüren. Und die Aufgabe der Galiani-Edition sei es, den Dichter von diesen kleinkarierten Spitzwegschen Spießern à la Fausts Famulus Wagner zu befreien.
Der lustige Wortakrobat?
Daniil Charms wird bei Galiani in erster Linie als Zauberkünstler, als ein Sprachartist dargestellt. Und nicht mehr. Freilich ist das Spiel mit Worten sehr signifikant für seinen Schreibstil, doch in Charms steckt viel mehr als nur der Jongleur. Ein Déjà-vu? Ein unheimliches Déjà-vu. Die erste in der UdSSR erschienene, noch nicht mal halbwegs vollständige Ausgabe von Charms („Polet v nebesa“, 1988, herausgegeben von Aleksandrov) bediente sich dieses Topos’. Charms als ein Zauberer, als ein Clown. So war der Bezug zur russischen Avantgarde ausgeblendet – denn nur so durfte Charms in der UdSSR überhaupt erscheinen. Charms als ein lustiger Wortakrobat.
Die Jahre sind vergangen und in Deutschland erscheint nun ein Buch mit der gleichen Intention. Doch nicht als Schutzmechanismus gegen die Zensur, sondern als Adaptation für „jedermann“, auch wenn man Charms eigentlich nicht zu adaptieren braucht – bei seiner Multidimensionalität finden alle Leser ihre eigenen Zugänge zu den Texten, ohne dass jemand diese Zugänge diktieren müsste. Doch was passiert nun mit den Texten selbst? Nehmen wir beispielweise die Gedichte von Charms, die nach der Behauptung von Galiani Verlag, „bislang kaum auf Deutsch zugänglich“ waren. Sie haben hier ein trauriges Schicksal.
Man macht Charms zugänglich. Man spielt mit der Wiedererkennbarkeit. Dazu verzichtet der Übersetzter zunächst auf die „quasi wissenschaftliche Transkription der russischen Wörter“ (Nachwort des Herausgebers, Band 1, S. 259). Also, Puschkin statt – „quasi“ wissenschaftlich – Puškin. (Mit „quasi wissenschaftlich“ ist ISO 9, der weltweite Standard zur Transliteration kyrillischer Schrift gemeint. Na gut, ich darf ja nicht mitreden als ein sezierender Schreckensphilologe).
Was tut man sonst (dem Werke an)? Es werden alle Namen eingedeutscht. Also „Herr Meier“ (Galiani) statt „Petr Palyč“ (Charms). „Hieronymus Dümpel“ (Galiani) statt „Ivan Toporyžkin“ (Charms). Eine Rettung für den deutschen Leser, der bereits bei Dostoevskij mit all den russischen Namen zu kämpfen hatte?
Dann wird behauptet, auf die „unnötigen“ Kommentare (s. Übersetzungen von Peter Urban mit den aufschlussreichen und fundierten Kommentaren im Anhang jeder Ausgabe – als freiwillige und optionale Lektüre) im Sinne einer besseren Text-Zugänglichkeit verzichten zu wollen. Und gleichzeitig ist fast jedes Gedicht (auf der gleichen Seite, so dass die Meta-Ebene ständig den Lesefluss unterbricht) mit einem mehr oder minder konstruktiven Kommentar versehen.
Der Übersetzer-Mime
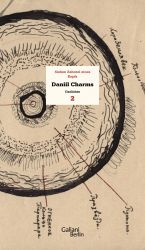 Doch die signifikanteste Vorgehensweise kommt noch. Nitzberg wendet Reim und Metrik an, und erreicht ausgerechtet das, was Urban vermeiden möchte. Urban nämlich verzichtet in seinen Übertragungen der lyrischen Werke oft auf Reim und Metrik und benutzt eine Interlinearübersetzung. Nicht nur bei Charms. Puškins Lyrik sei unübersetzbar, sagt Urban, und recht hat er. Denn Lyrik kann man zwar aus einer Sprache in die andere transferieren, doch es wird ein völlig neues Werk sein. Man wird aber keinen originalen Dichter mehr erleben, sondern – es tut mir leid! – nur den Übersetzer in seinem Kultur- und Sprachkontext. Die ganzen Anspielungen und ganzen Klänge ändern sich gewaltig gegenüber dem Original. Eine alte Geschichte. Soll man auf Übersetzungen der lyrischen Werke deswegen also verzichten? Nicht unbedingt. Zumindest, wenn man den Kern der Werke nicht verunstaltet. Doch was passiert hier?
Doch die signifikanteste Vorgehensweise kommt noch. Nitzberg wendet Reim und Metrik an, und erreicht ausgerechtet das, was Urban vermeiden möchte. Urban nämlich verzichtet in seinen Übertragungen der lyrischen Werke oft auf Reim und Metrik und benutzt eine Interlinearübersetzung. Nicht nur bei Charms. Puškins Lyrik sei unübersetzbar, sagt Urban, und recht hat er. Denn Lyrik kann man zwar aus einer Sprache in die andere transferieren, doch es wird ein völlig neues Werk sein. Man wird aber keinen originalen Dichter mehr erleben, sondern – es tut mir leid! – nur den Übersetzer in seinem Kultur- und Sprachkontext. Die ganzen Anspielungen und ganzen Klänge ändern sich gewaltig gegenüber dem Original. Eine alte Geschichte. Soll man auf Übersetzungen der lyrischen Werke deswegen also verzichten? Nicht unbedingt. Zumindest, wenn man den Kern der Werke nicht verunstaltet. Doch was passiert hier?
Die Intention der Galiani-Edition ist lobenswert: Charms’ Texte erlebbar, „goutierbar“ (Band 2, S. 295) zu machen. Die beim Lesen der russischen Originaltexte immer entstehende Freude und Faszination mit dem deutschen Leser zu teilen. Doch leider sind die Übertragungen der lyrischen Texte oft problematisch: Der Übersetzer schimmert durch den Text im Versuch, das Original nachzuempfinden. Und gerade das ist es, was den Dichter in dieser Ausgabe so verzerrt. Der Leser mag auch erhoffen, den Sprachakrobaten Charms zu rezipieren, doch er rezipiert stattdessen den Sprachakrobaten Nitzberg.
.
Besonders deutlich wird das bei der Übersetzung des verhängnisvollen Gedichts „Iz doma vyšel čelovek“ („Ein Mensch ging aus dem Haus“), geschrieben in dem nicht weniger verhängnisvollen Jahr 1937. Nach diesem in einer Kinderzeitschrift veröffentlichten Gedicht war Charms endgültig ins Visier der stalinistischen Repressalien geraten, er wurde mehrmals verhaftet, er hatte keine Chance mehr, gedruckt zu werden. Nicht einmal für Kinder.
In diesem Gedicht wird ein Mensch beschrieben, der für eine lange Wanderung gut ausgerüstet sein Haus verlässt und losgeht, ohne Pause und Schlaf zielstrebig immer weiter geht, bis er einen dunklen Wald erreicht und in diesem Wald verschwindet. Das Gedicht ist schlicht. Einfach. Ohne jegliche Wortspiele und Avantgardismen. Direkt, und deswegen schaurig. Doch dieser Schauer, diese Direktheit gehen verloren unter den manieristischen Bemühungen Nitzbergs, auch hier den Sprachakrobaten Charms zu mimen:
Ein Mann mit Säckchen und mit Stock
trat einmal aus dem Haus
und in die Wolt,
und in die Wult,
und in die Welt hinaus
Alle möglichen Interpretationen (und die politische Deutung ist nur eine von dutzenden Lesearten dieses großartigen Werkes) schwinden. Was bleibt, ist Wolt und Wult. Wieso ausgerechnet dort, wo es um die Welt geht? Und so entsteht durchaus ein neues Bild von Charms – zumindest für westliche Leser. Ein Bild aus sowjetischen Zeiten. Ein Clown, ein schräger Vogel. Frei von intertextuellen Bezügen, frei von jeglichen Akademismen. Einfach urkomisch und wundersam. Ein bisschen Spaß muss sein.
Ja, das ist auch ein Charms, ein neuer Charms, ein anderer Charms. Ein verständlicher Charms. Ein popularisierter Charms. Ein Charms-für-alle. Ein ärmerer Charms. Das ist eigentlich alles.
Vladimir Alexeev
Kleines Lied (Urban)
Einst ging ein Mensch aus seinem Haus
in Mantel Stock und Hut
Lang ist der Weg
lang ist der Weg
der vor ihm auf sich tut.
Er ging und ging geradeaus
und schaute nicht beiseit.
Nicht schlief nicht trank
nicht trank nicht schlief
er gestern, morgen, heut.
Und eines Tags im Morgengraun
stand er im dunklen Wald
Und seit der Zeit
und seit der Zeit
er für verschwunden galt.
Begegnet ihr ihm irgendwann
an irgend einer Stell
dann sagt es uns
dann sagt es uns
dann sagt es uns ganz schnell.
Liedchen (Nitzberg)
Ein Mann mit Säckchen und mit Stock
trat einmal aus dem Haus
und in die Wolt,
und in die Wult,
und in die Welt hinaus.
Er schaute nur geradeaus,
geradeaus er lief,
wobei er
weder trank noch aß
noch aß noch trank noch schlief.
Bis er sich eines Morgens früh
im dunklen Wald befand,
worauf er dinn,
worauf er donn,
worauf er dann verschwand.
Und trifft ihn einer unter euch
so rein eventuell,
dann sagt es ins,
dann sagt es ans,
dann sagt es uns ganz schnell.
Daniil Charms: Werke in 4 Bänden. Herausgegeben von Vladimir Glozer und Alexander Nitzberg. Berlin: Verlag Galiani 2010/11. Mit diversen Abbildungen. Gebunden, Fadenheftung, Lesebändchen. 24,95 Euro.
Band 2: Sieben Zehntel eines Kopfs. Gedichte. Aus dem Russischen übersetzt von Alexander Nitzberg. 320 Seiten. 24,95 Euro.
Eine Rezension von „Marina Durnowo: Mein Leben mit Daniil Charms“ finden Sie hier











