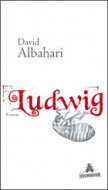 Nichts als ein übler Verräter
Nichts als ein übler Verräter
David Albaharis grandiose Abrechnung mit den Gesetzen des Literaturmarkts. Von Carl Wilhelm Macke
Vordergründig ist der „Plot“ von Ludwig, dem neuen Roman von David Albahari, leicht zu erzählen. Ein serbischer Schriftsteller neidet einem anderen schreibenden Kollegen dessen Erfolg im Literaturbetrieb. In einer weder durch Absätze noch durch Luftholen unterbrochenen Suada schlägt der Verlierer, das Erzähler-Ich, auf den Gewinner, den großen, in aller Welt geschätzten Schriftsteller ein.
Es gibt nichts, womit Ludwig, der andere, der frühere Freund und heutige Feind es verdient hätte, zum Liebling der Medien, der Frauen und der ganzen Belgrader Gesellschaft geworden zu sein. Schlimmer noch, Ludwig verdankt seinen Erfolg einzig und allein seinem ehemaligen Freund, der ihm alle Ideen, ja fast auch alle Formulierungen für sein „Buch der Bücher“ geliefert hat. Wo der gescheiterte Schriftsteller auftaucht, immer ist da der Erfolgreiche, der Berühmte, der Liebling aller Kritiker schon in allen Gesprächen anwesend. Bereits im morgendlichen Frühstücksfernsehen spricht man nur von Ludwig und seinem Buch der Bücher. „Ich hatte ihm nicht nur das Buch diktiert, das ihn berühmt machen sollte, sondern auch seine neuen Erzählungen redigiert, einige chaotische Essays verbessert und die Neuauflage eines seiner frühen Romane betreut, der so schlecht war, daß ich ihn buchstäblich neu schreiben mußte.“
Eifersucht, Neid? Es gibt in dem Buch tatsächlich wunderbare Passagen, mit denen der Leser seinen Wortschatz zur Abqualifizierung, zur Demütigung, zur Erniedrigung eines grundlos Erfolgreicheren, als man selbst es ist, auffrischen kann. Albahari zieht hier alle Register, um über den anderen, der sich mit Gaunereien, Verrat, Schmeicheleien einen Platz auf der Sonnenseite des Lebens ergattert hat, herzuziehen. „Er erzählt schon lange, was er will, vor allem seit Belgrad ihn als seinen Lieblingsschriftsteller an die Brust gedrückt hat, und man in dieser Stadt keinen Schritt mehr tut, ohne vorher seinen Rat einzuholen, als hätte er für alles unter dem Himmelszelt ein Heilmittel oder ein Rezept. Nur wer mit ihm gelebt hat, weiß, wie absurd das ist, weil Ludwig ein total unpraktischer Mensch ist, außerstande, für sich zu sorgen …“
Selbstgespräch eines Zwillingsbruders
Aber natürlich bemerkt der Leser bei aller Freude über die Wortgewalt, die das Erzähler-Ich auf den Sunnyboy Ludwig niederprasseln lässt – und nicht zuletzt auch auf die vollkommen verkommene Belgrader Society –, dass es in diesem Roman um mehr geht als eine kleine böse Eifersuchtsgeschichte. Es geht auch und vor allem um eine Abrechnung mit den Gesetzen der Mediengesellschaft und besonders des Literaturmarkts, dessen Kriterien andere sind als desjenigen, der versucht, mit seiner Arbeit auch Qualitätsmaßstäbe zu setzen, der etwas zu sagen hat, das mehr ist als das Gequatsche in den Talk-Shows. Wer wie Ludwig in die Bestsellerlisten kommen will, muss nicht unbedingt schreiben oder erzählen können. Er muss vielmehr auch bereit sein, sich zu verkaufen, sich zu prostituieren, sich den Profitinteressen von Verlagen und Fernsehgesellschaften unterzuordnen. Notfalls muss er auch, so wie jener Ludwig, bereit sein, persönliche Freundschaften zu zerstören, nur um des eigenen Erfolgs und der angeblich eigenen Unsterblichkeit im Kulturleben seines Landes willen.
Dieser Ludwig, auch das wird einem bei der Lektüre schnell bewusst, ist aber immer auch eine Art Zwillingsbruder des wegen seines Misserfolgs so verzweifelnden Erzähler-Ichs. Der andere wird hier immer wieder auch als „das Eigene“ erkennbar: „In Ludwigs Leben, selbst als wir uns ganz nahe standen, gab es schon immer einen Teil, der mir verborgen blieb, wie hätte er sonst sein Buch der Bücher schreiben können?“ Dieses obsessive Einschlagen auf den anderen ist doch letztlich nichts anderes als ein atemloses, absatzloses Selbstgespräch mit den „verborgenen Teilen“ in der Gefühlswelt des eigenen Ich.
Der aus dem nationalistischen Serbien der Milo¨evi?-Jahre nach Kanada geflohene David Albahari schreibt sich mit seinen Romanen langsam hinein in die Reihe international erfolgreicher Schriftsteller. Er aber verrät niemanden, verkauft seine Seele nicht an den Markt und die Belgrader „Kitsch-Gesellschaft“, die hier bitterböse nach allen Regeln der Ironie und des Sarkasmus seziert wird. Er kann wirklich schreiben, hat etwas zu sagen, beherrscht souverän alle Nuancen der Sprache – und hat in Mirjana und Klaus Wittmann auch exzellente Übersetzer seiner Werke. Zwischen mir und Ludwig „war eine Freundschaft, die eine Zeitlang währte und dann erlosch, verblich, verwelkte, verdorrte, verging, abflaute, zerbrach, zerfiel, auseinanderfiel, verschwand und noch viele andere Wörter, die dasselbe meinen, weil keines von ihnen allein ausreicht, das zu beschreiben, was passierte“. Auch wenn es dem Erzähler-Ich vielleicht einen neuen Stich versetzt – Ludwig ist ein grandioser Roman – geschrieben aber zweifellos von David Albahari, nicht von Ludwig.
Carl Wilhelm Macke
David Albahari: Ludwig (Ludvig, 2007). Aus dem Serbischen von Mirjana und Klaus Wittmann.
Frankfurt a. M.: Eichborn Verlag 2009. 152 Seiten. 17,95 Euro.











