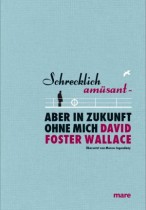 Anleitung zum Unglücklichsein
Anleitung zum Unglücklichsein
Foster Wallace’ virtuoser Kreuzfahrtreport ist ein Ausflug in die Abgründe der Konsumgesellschaft.
„Ich habe sacharinweiße Strände gesehen, Wasser von hellstem Azur. Ich habe erfahren, wie Sonnenmilch riecht, wenn sie auf 21.000 Pfund heißes Menschenfleisch verteilt wird. Ich bin in drei Ländern mit „Mään“ angeredet worden. Ich habe 500 amerikanischen Leistungsträgern beim Ententanz zugeschaut. Ich habe Sonnenuntergänge erlebt, die aussahen wie nach einer digitalen Bildbearbeitung. Ich habe erwachsene US-Bürger aus dem gehobenen Mittelstand gehört, erfolgreiche Geschäftsleute, die am Info-Counter wissen wollten, ob man beim Schnorcheln nass wird, ob die Crew ebenfalls an Bord schläft oder um welche Uhrzeit das Midnight-Buffet stattfindet …“
Wenn David Foster Wallace zu Beginn seiner Reiseerzählung „Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich“ zusammenfasst, was ihm auf sieben Tagen Luxuskreuzfahrt durch die Karibik widerfahren ist, ist eins sofort klar: Foster Wallace Flirt mit der Reiseliteratur ist mehr als ein bis ins kleinste nautische und werbepsychologische Detail recherchierter Essay über eine Schiffsreise. Aber wer erwartet schon, dass eine ganz normale Urlaubsreportage herauskommt, wenn das „Harper’s Magazine“ den amerikanischen Kultautor Foster Wallace auf eine „7-Night-Caribbean“-Kreuzfahrt schickt?
„Schrecklich amüsant …“ schlägt Funken der Originalität, weil Foster Wallace nicht den neutralen, unbeteiligten Beobachter gibt, sondern minutiös protokolliert, wie das Gesehene, Erlebte, Gehörte, all der übertriebene Luxus und der Terror der fürsorglichen Entmündigung auf ihn, auf seine Empfindungen und seinen Seelenhaushalt wirken. Er dringt dabei weit in die Tiefen der eigenen Wahrnehmung und Psyche vor, oder genauer in die des Bildes, das er in diesem Text von sich entwirft: ein durchgeknallter Schriftsteller, der voller Ängste, Obsessionen, Manien und Zwangsvorstellungen steckt, der sich davor ekelt Amerikaner zu sein, aber ahnt, dass gerade seine Distanzierungsversuche einem „Selbstdarstellungsprogramm“ gehorchen, das typisch für die amerikanische Oberschicht ist. „Ich werde das dumme Gefühl nicht los, dass ich ein amerikanischer Tourist bin und dadurch per se ein stiernackiger, lauter, vulgärer, großkotziger Fettsack, eitel, verwöhnt, gierig und zugleich gepeinigt von Scham und Verzweiflung“.
Während die „normalen Upper-Class-Passagiere“ des 47.255-Tonnen-Luxus-Schiffs der amerikanischen „Celebrity Cruise“-Line dem verheißenen Verwöhnprogramm nachgehen und 11 Mahlzeiten pro Tag genießen, am Pool entspannen oder an einem Karibik-Landgang teilnehmen, wird die den Tag an Deck bestimmende „Wir-erfüllen-Wünsche-von-denen-Sie-nicht-zu-träumen-wagten“-Maxime für Foster Wallace zum Trauma. Wenn er die Dauerüberwachung der Kabinen und Gänge durch unsichtbare Putzkolonnen als ihn quälenden Reinhaltungswahn beschreibt oder die Gesundheits- und Fitness-Aufbauprogramme für Passagiere als Methode, den Traum des Siegs über den Tod zu erarbeiten, wenn ihn bei jedem „Professional Smile“, dem „mittlerweile pandemischen Service-Lächeln im amerikanischen Dienstleistungssektor“ Verzweiflung überkommt, vermischt sich sein analytischer Blick auf die ihn umgebende Welt mit einer überscharfen Selbstwahrnehmung.
So schildert er nicht nur den Mikrokosmos eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes als Symbol des „American Way of Life“, sondern auch sich als abhängiges, fremdgesteuertes Opfer der zeitgenössischen Medien-, Konsum- und Lifestyle-Gesellschaft. Einerseits postuliert er mit jeder Aktion an Deck sein Anders-Sein, seine Differenz zur Masse, andererseits findet er überall Indizien, warum gerade diese das Selbstwertgefühl erhaltende Differenz eine Illusion ist. Wenn er einen alten Greis mit einem Camcorder beschreibt, den er Captain Video nennt, weil seine gesammelten Kassetten „einmal ein Filmdokument ergeben, das exakt so lang ist wie die Kreuzfahrt selbst – und so langweilig wie Warhol“, verschweigt er nicht, dass das auf seine eigenen, unzählige Blöcke füllenden Notizen ebenso zutrifft. Sein Schreibzwang ist einfach nur die intellektuelle Variante einer unentrinnbaren Logik des Begehrens.
Doch der vorliegende Text – sozusagen die gekürzte Variante seiner Notizen – ist alles andere als langweilig. Ständig nutzt Foster Wallace die Vitalität seiner Sprache für bittere Pointen, verspielte Metaphern und ebenso amüsante wie zutreffende Vergleiche. So ist dieses virtuose Essay ein Juwel seiner mutigen, unvorhersehbaren, unprätentiösen, teilweise überzogenen und auf angenehme Art traditionsfreien Erzählkunst.
Textauszüge:
Ein bei Megalines gern verwendeter Slogan lautet: „YOUR PLEASURE IS OUR BUSINESS.“ Was in normaler Werbung lediglich doppelsinnig klingt („Ihre Urlaubsfreuden sind unser Beruf/liegen uns am Herzen“), besitzt hier sogar noch eine dritte, beinahe einschüchternde Bedeutung: „HALTEN SIE ENDLICH DIE SCHNAUZE UND LASSEN SIE UNS PROFIS NUR MACHEN. WAS WAHRE URLAUBSFREUDEN SIND UND WAS NICHT, WISSEN WIR IMMER NOCH AM BESTEN.“
In verschiedenen Sitzreihen nehmen verschiedene Leute ihre Camcorder auseinander wie Soldaten ihre Waffe.
Cruise Director Scott Peterson zählt zu jenen Menschen, für die weiße Turnschuhe (ohne Socken) und mintgrüne Lacoste-Shirts einst erfunden wurden. Seine ganze Art lässt sich am besten dadurch beschreiben, dass er anscheinend ständig für ein Foto posiert, das niemand macht.
Markus Kuhn
David Foster Wallace: Schrecklich amüsant – aber in Zukunft ohne mich. Roman.
Aus dem Amerikanischen von Marcus Ingendaay.
marebuchverlag 2002. Gebunden, 183 Seiten. 18,00 Euro.











