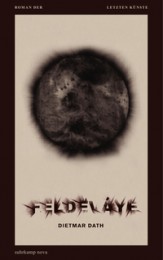 Das Zurückholen der Geschichte
Das Zurückholen der Geschichte
–Von Elfriede Müller
Die Beziehungen zwischen Utopie, Anti-Utopie, Dystopie und Science Fiction gehen weit zurück. Je nach politischer Haltung oder Weltanschauung dient das Genre der Science Fiction dazu, Kulturpessimismus auszuagieren, Utopien zu beschreiben und Gesellschaftskritik zu formulieren. Vor allem die moderne Science Fiction ab H. G. Wells verliert sich gerne in technischen Spielereien und deren Auswirkungen auf das soziale Leben. Die Literatur der Science Fiction ist vom Begehren nach technologischem und sozialem Fortschritt wie auch der Angst davor durchdrungen. Die literarische Beschreibung einer fiktionalen Welt, die sich von Vergangenheit und Gegenwart unterscheidet, ermöglicht drastischere Bilder und Fantasien und eine Transzendenz der Totalität der gegenwärtigen Vergesellschaftung. In dieser Weise sah Adorno im gelungenen Kunstwerk bereits das Neue, Andere, Emanzipatorische aufscheinen. Dietmar Dath wird häufig seine Nähe zu Lenin vorgeworfen, doch verliert er dabei die Kritische Theorie nie aus den Augen, was auf eine pragmatische Politikhaltung schließen lässt.
Wir befinden uns im Jahr 2150. Die Menschen leben mit anderen Intelligenzwesen in 40 Welten auf Sternengruppen, Galaxien, Planeten, Kontinenten. Die Emanzipation der Tiere ist weit fortgeschritten, es gibt auch Zwischenwesen wie in der Antike: die Padurn. Schlangen proben den Aufstand, unterrichten Vögel darin und vor allem im Sprechen. Die Vielfalt der Arten, die die Gesellschaft bilden und auch gestalten wollen, hat sich enorm erweitert und eine neue Art von Klassenkampf hervorgebracht, der zum Teil auch zwischen den Arten stattfindet. Das (nicht nur menschliche) Gehirn ist eine Art manipulierbare Festplatte geworden. In einem Wesen können mehrere Identitäten existieren, nicht nur in einem abstrakten, sondern ganz konkreten Sinn. Eine der zentralen Figuren des Romans, Severin Rukeyser, vereint im Laufe der Handlung fünf Personen in seiner körperlichen Hülle.
Im Zentrum der verworrenen Handlung steht ein abgelegener Planet, auf dem Menschen und vor allem Kathrin Ristau, die blasse Hauptfigur, auf zunächst ein Kunstwerk und nach und nach die Kunst an sich stößt, die als abgeschlossen bzw. verwirklicht angesehen wird. Die Vergesellschaftung ist nicht total, es gibt unterschiedliche Formen der Opposition, vor allem Gruppen, die sich darauf spezialisieren, Kunstwerke aus vergangenen Zeiten „vor der Hidschra“ auszugraben und damit ein Versprechen der Emanzipation und der Kooperation zwischen den Arten wieder lebendig werden lassen.
Der Ausgangspunkt des Romans ist die Reise eines Liebespaars, Severin und Clemens, die wie die Made im Speck leben, aber denen „etwas fehlt“ und die sich aufmachen nach Feldeváye: „ein Fluchtname und Auswegweiser“, wenn auch mit Minderheitenproblemen, Tiermigration usw. In gewisser Weise konzentrieren sich dort die Konflikte, die es überall sonst auch gibt. Viele Beschreibungen erinnern an Ernst Bloch: der Ort, an dem noch niemand war. Geld spielt nur noch eine marginale Rolle, es existiert eine Art Tauschwirtschaft. Die Welten scheinen zunächst dem Mangel entwachsen. Krankheiten können erschaffen und weggebeamt werden. Der Begriff der Zeit ist ein anderer geworden, die Arten werden mehrere 100 Jahre alt, schlafen mal vier Jahre durch, wenn es sein muss, oder werden unfreiwillig eingeschläfert, wenn sie Herrschende beim durchregieren stören.
Es gibt um die 20 Hauptwesen, die sich dann auch zu mehreren in einem Wesen wiederfinden können. Es hätte eines Personenverzeichnisses wie eines Glossars bedurft, um diese Wesen im Laufe der Geschehnisse nicht zu verlieren. Viele tauchen am Anfang auf, verlieren sich nicht nur in den vielen Seiten sondern auch in verschiedenen Identitäten, um am Ende, wenn die Handlungen sich actionfilmhaft zuspitzen als Deus ex machina aus dem Nichts hervorzutreten. Aber dieser Mühe unterziehen sich heutzutage ja nur noch Kleinverlage, die Bücher aus Liebe und Leidenschaft produzieren…
Weniger wäre mehr gewesen
Die Genderfrage hat in der Zukunft eine andere Wendung genommen, Frauen sind bei den Menschen das bestimmende Geschlecht, Familien existieren weiter, werden auch nicht in Frage gestellt: „Geschlechter, na gut. Es wird schon irgendeinen Natursinn gehabt haben – ich bin auch nicht dafür, sie ganz wegzureduzieren, auf eins.“ So lebt auch Kathrin Ristau, die als Retterin der Künste zur Retterin der Emanzipation werden wird, in verschiedenen Familienkonstellationen. Einer ihrer flüchtigen Jugendlieben wird zum bösen Gegenpart, wird vom sozial schwachen und geächteten zum fiesen Herrscher, der alles und alle nur zerstören möchte. Durch den Text geistert die „Auswertung“, eine Art Aufstellung aller Kunstwerke, ein kollektives Gedächtnis (das überprüft, katalogisiert und genehmigungspflichtig macht), das diejenigen, die für sie tätig sind, zu instrumentellen Charakteren werden lässt.
Es gibt einige schöne Liebesszenen und interessanten Liebeshändel, doch verbleibt letztendlich alles in recht traditionellen Bahnen. Die schrittweise Wiedereinführung der Geldwirtschaft ist ein Anzeichen dafür, dass die Reaktion an Terrain gewinnt, dass Teile der Selbstorganisierung zurückgeschraubt werden. Soweit, dass es zu Krieg, Folter und Zerstörung kommt. Vorher hat Ristau einen Text veröffentlicht, einen Grundlagentext, der die Welten in eine emanzipatorische Richtung durch die Künste bringen könnte: „… geht es ‚der Kunst‘ vor allem auf eine andere Art als sonstiger Erkenntnis um ‚Inhalte‘“. Der Roman steckt voller philosophischer und künstlerischer Referenzen, ohne dabei explizit zu werden und verliert sich auch darin. Benjamin, Meret Oppenheim, Bloch, aktuelle Kunstdiskurse zu Performance und Partizipation, technizistische Spielereien wollen noch keinen Roman bilden, der die Leser über 800 Seiten bei der Stange hält.
Scheinbar ist Dath über die aktuelle Manifestprosa auf dem Laufenden, denn er macht wie z. B. „Der kommende Aufstand“das Landleben stark und siedelt die Konterrevolution vor allem in den Städten oder städteähnlichen Orten der Zukunft an. Und wenn sich dann der Himmel als Blütenkelch öffnet, ist das nur noch Kitsch. Überhaupt scheint der Autor unentschieden, ob er ein Manifest, einen gesellschaftskritischen Essay oder einen Roman schreiben will. Diese Unentschiedenheit zieht vor allem den Mittelteil in die Länge, ohne dass die Figuren und Wesen dabei an Format, noch die Handlung an Struktur gewinnt. Dath hätte sich an der letzten Schrift seines Vorbilds Lenin orientieren können: „Lieber weniger, aber besser.“
Der durch den ausbrechenden Krieg eingeleitete Schlussteil wird rasanter, hin und wieder spannend und endet doch wie eine Hightech-Produktion aus Hollywood. Jedenfalls schließt sich der Kreis der Akteure, die alle am Ende plötzlich wieder auftauchen, wenn auch häufig in anderer Gestalt. Das mag auch daran liegen, dass „die Welt gar nicht eine ist, sondern viele.“
Elfriede Müller
Dietmar Dath: Feldeváye. Roman der Letzten Künste. Frankfurt/M. 2014. Suhrkamp Verlag. 807 Seiten. 20,00 Euro.











