Stau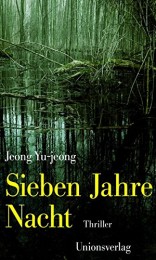 seemonster, Zulu-Schönheit und sexy Norah
seemonster, Zulu-Schönheit und sexy Norah
– Mehr Transparenz wird häufig gefordert, wenn es um Juryentscheidungen geht. Die gibt es hier: Drei Juroren der Litprom-Bestenliste, Anita Djafari, Katharina Borchardt und Thomas Wörtche, haben sich zusammengesetzt und drei Titel, die in der näheren Auswahl für den aktuellen Weltempfänger standen, diskutiert. Dabei waren sie nur manchmal einer Meinung.
■ Anita Djafari: Schön, dass wir zufällig drei Autorinnen ausgesucht haben. Wir haben ja beim Weltempfänger keine Frauenquote, das verbietet sich. Wobei ich den Thriller Sieben Jahre Nacht von Jeong Yu-jeong zunächst einem Autor zugeschrieben habe. (Meine Klischeevorstellungen!) Ich war jedenfalls gefesselt von der ersten bis zur letzten Seite und hatte ein durchgängiges Gefühl von „Schwärze“. Es geht um den Alptraum eines jungen Mannes, dessen Vater von der Allgemeinheit zum „Stauseemonster“ erklärt wurde, weil er ein Dorf überflutete. Warum er das tat, entfaltet die Autorin in einer gut durchkomponierten Geschichte, bei der eigentlich von Anfang an alles klar ist. Beeindruckend!
■ Thomas Wörtche: Ein Gefühl von Schwärze hatte ich eigentlich nie und wäre auch nie – Klischee hin oder her – auf die Idee gekommen, ein Mann könne den Roman geschrieben haben. Angesichts von Patricia Highsmith oder Masako Togawa scheint mir diese Tradition näherzuliegen als der in den Paratexten aufgerufene Stephen King. Nach knalligem Anfang beginnt die Seelenzergliederung der Hauptfiguren – sagen wir: Männer lösen Problematiken eher in Action auf – und zieht sich endlose 500 Seiten hin. Bis am Ende ein Masterplan sichtbar wird – der Vater, der aus der Todeszelle die Bewegungen des Feindes antizipiert und mit dem Onkel der Hauptfigur zu einem Narrativ fügt –, das finde ich eher sehr gezwungen konstruiert.
■ Katharina Borchardt: Ich fand den Roman auch psychologisch stark auserklärt. Jeong erzählt die Geschichte ja – personal und aus der Ich-Perspektive – aus verschiedenen Blickwinkeln. Mich hat er in der ersten Hälfte sehr gepackt. Sehr! Aber dann wurden mir die Psychen und Beweggründe der Figuren doch zu stark ausgebreitet.
■ AD: Stimmt, Thomas, ich erkenne auch mehr Nähe zu Patricia Highsmith als zu Stephen King. Die Kritik an der „Seelenzergliederung“ oder zu starken Auserklärung der Figuren teile ich nicht. Mir sind die Figuren und ihre Beweggründe sehr nahe gekommen. Es ist dieser eine Moment, der ein Leben auf den Kopf stellt. Ein Mann begeht einen tödlichen Fehler, er überfährt einen Menschen und beseitigt ihn. Nachvollziehbar, schon oft gesehen oder gelesen im Krimi. Aber es geht doch um die Hölle, die dieser Mensch in sich trägt und was das Ereignis mit ihm macht. Und das ist immer wieder anders. Hier in einem besonderen Setting – einem fiktiven Dorf an einem Stausee in Südkorea. Da wird mir auch etwas erzählt über die familiären Beziehungen der Menschen in dieser Gesellschaft: kalt, berechnend und todtraurig zugleich.
■ TW: Ja, der soziologische Beifang (den ich aber auf der Ebene, auf der sich der Roman bewegt, der ja nicht wirklich schlecht ist, auch erwarte) ist schon okay. Die „Hölle Mensch“ ist mir aber zu zäh, zu langatmig, zu (spannungsdramaturgisch) durchhängend. Das Problem scheint mir in der Brüchigkeit der Konzeption zu liegen. Einerseits overplotted (Mastermind), andererseits psychologischer Realismus und am Ende dann noch ein dezidiertes Stilmittel des klassischen Golden-Age-Whodunits, die Ortsskizze (in nicht parodistischer oder sonst wie brechender Absicht). Positiv: Die Meeres- und Tauchszenen (männliche Abenteuerlust meinerseits?), da kommen wirklich spannende Dimensionen ins Spiel.
■ KB: Ja. Eine der fantastischsten Szenen ist der Unterwasserspaziergang von Tauchspezialist Onkel Sunghwan durch das geflutete Dorf am Grunde des Stausees. Eine fantastisch fahle, wasserpflanzige Szenerie! Einwerfen möchte ich, dass Jeongs Thriller auch einige Action aufzuweisen hat, vor allem zum Ende hin. Nicht dass hier ein falscher Eindruck entsteht. In Korea war das Buch auch deshalb ein Bestseller. Koreanische Krimis gibt es in deutscher Übersetzung bislang kaum. Da hat die in Swasiland geborene Malla Nunn natürlich viel mehr Konkurrenz aus Südafrika!
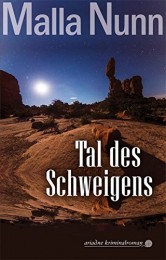 ■ AD: Ja, der Krimi Tal des Schweigens. Malla Nunn hat mehr „Konkurrenz“ durch hierzulande gut bekannte südafrikanische Krimi-Autoren. Nunn hat einen grundsolide und kraftvoll erzählten Kriminalroman vorgelegt. Gründlich recherchiert. Die Autorin, die heute in Australien lebt, kennt sich aus in „ihrer“ Geschichte; der Roman spielt in den 1950er Jahren und lässt tief blicken in die rassistische Gesellschaft von damals.
■ AD: Ja, der Krimi Tal des Schweigens. Malla Nunn hat mehr „Konkurrenz“ durch hierzulande gut bekannte südafrikanische Krimi-Autoren. Nunn hat einen grundsolide und kraftvoll erzählten Kriminalroman vorgelegt. Gründlich recherchiert. Die Autorin, die heute in Australien lebt, kennt sich aus in „ihrer“ Geschichte; der Roman spielt in den 1950er Jahren und lässt tief blicken in die rassistische Gesellschaft von damals.
■ TW: Genau, das macht Malla Nunn sehr stark. Anders als ihre Kollegen Andrew Brown, Deon Meyer und Mike Nicol (den Krakeeler Roger Smith lassen wir mal außen vor) gräbt sie tiefer. Tal des Schweigens ist weniger makropolitisch als ihre beiden anderen Cooper/Shabalala-Romane (Ein schöner Ort zum Sterben, Lass die Toten ruhen) und fächert in einem klassischen Whodunit die zutiefst rassistische, aber auch von Antagonismen von Buren und Engländern geprägte Situation auf. Der Tod eines Zulu-Mädchens interessiert im Grunde niemanden, dennoch hat er weitreichende Implikationen für die gesamte Bevölkerung von Drakensberge. Und überhaupt, da spielt eben DS Shabalala eine große Rolle, ohne dessen interkulturelle Kompetenz geht gar nichts. Da liegt schon ein Funken Utopie für spätere Zeiten. Zudem kann Nunn sehr liebevoll, gar poetisch mit Natur umgehen. Und wunderbar sarkastisch sein.
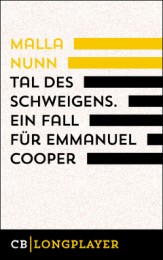 ■ KB: Ich habe Tal des Schweigens wie auch Malla Nunns vorherige Krimis einfach so weggesüffelt. Wie macht sie das nur, dass ihre Bücher so wahnsinnig eingängig sind, ohne aber simpel zu sein? Die geschmeidige Übersetzung hat natürlich ihren Anteil daran, aber die Autorin versteht es auch, dem Plot eine packende Rhythmik zu geben: Immer wieder zieht die Geschichte an, um dann auch wieder Zeit für politische und historische Reflexion zu lassen. Angenehm, dass bei ihr weniger gemetzelt wird als bei ihren männlichen Kollegen.
■ KB: Ich habe Tal des Schweigens wie auch Malla Nunns vorherige Krimis einfach so weggesüffelt. Wie macht sie das nur, dass ihre Bücher so wahnsinnig eingängig sind, ohne aber simpel zu sein? Die geschmeidige Übersetzung hat natürlich ihren Anteil daran, aber die Autorin versteht es auch, dem Plot eine packende Rhythmik zu geben: Immer wieder zieht die Geschichte an, um dann auch wieder Zeit für politische und historische Reflexion zu lassen. Angenehm, dass bei ihr weniger gemetzelt wird als bei ihren männlichen Kollegen.
■ AD: Und toll, dass man ein Buch mit so viel Substanz einfach so wegschmökern kann. Die Geschichte hallt nach, und man hat auf unanstrengende Weise noch etwas gelernt. Große Kunst! Jetzt noch zu Kettly Mars und ihrem schmalen Roman Ich bin am Leben. Alles andere als ein Krimi. Es ist das Porträt einer haitianischen Familie der Oberschicht, ausgehend von der Erdbebenkatastrophe im Jahr 2010. Der an Schizophrenie erkrankte älteste Sohn der Familie, Alexandre, muss die Anstalt, in der er seit 40 Jahren lebt, plötzlich verlassen, weil dort die Cholera ausgebrochen ist, und kehrt heim. Diese erzwungene Rückkehr bringt das Gefüge der Familie durcheinander, unter den Teppich Gekehrtes bricht wieder auf. Erzählt wird das Ganze abwechselnd aus der Perspektive der verschiedenen Familienmitglieder.
■ TW: Ich mag dieses Buch, weil es so rätselhaft, für nichts irgendwie typisch und ziemlich unversöhnlich daherkommt. Der „Störfall“ des heimgekehrten Alexandre löst zwar bei der Familie (mittlere Oberschicht, aber keine „Führungselite“, insofern für Haiti ein ungewöhnliches Setting) Irritationen aus, die in den kleinen Eisinseln ihrer jeweiligen Statements zwar Unsicherheit, Kompensationsrhetorik und mehr oder weniger Selbstreflexionen auslösen, aber zu keinem Ende, und schon gar keinem glücklichen oder tragischen, führen. Letztendlich ist auch Alexandre nur ein weiter kontingenter Faktor in einer ziemlich zerrütteten Welt. Man kann, wenn mal will, an der Stelle einen noir-Aspekt sehen, der explizite Gewalt (nur psychische) oder Verbrechen nicht braucht. Ein schmaler Roman, der nicht „aufgeht“, dessen einzelne Narrative sich gegenseitig blockieren. Der Anarchist in mir findet so was gut. Breitenkompatibel ist das wohl nicht.
 ■ KB: Breitenkompatibel ist auch die Aufmachung des Buches nicht, wenn ich das mal einwerfen darf. Der Roman ist ein Print-on-demand-Taschenbuch mit dünnem Papier und extrem vollen Seiten. Da müsste der kleine Litradukt-Verlag, der eine fantastische Arbeit leistet, dringend mal upgraden. Inhaltlich muss so ein Roman auch nicht die Massen beglücken. Kettly Mars hat eine sehr fein ziselierte psychologische Studie einer haitianischen Familie geliefert, die mehr als nur ein Alexandre-Problem hat.
■ KB: Breitenkompatibel ist auch die Aufmachung des Buches nicht, wenn ich das mal einwerfen darf. Der Roman ist ein Print-on-demand-Taschenbuch mit dünnem Papier und extrem vollen Seiten. Da müsste der kleine Litradukt-Verlag, der eine fantastische Arbeit leistet, dringend mal upgraden. Inhaltlich muss so ein Roman auch nicht die Massen beglücken. Kettly Mars hat eine sehr fein ziselierte psychologische Studie einer haitianischen Familie geliefert, die mehr als nur ein Alexandre-Problem hat.
■ AD: Litradukt kann man nicht genug loben für die gute Literatur aus Haiti, die er dem deutschen Lesepublikum zugänglich macht. Umso wichtiger, dass die Bücher auch ansprechend gemacht werden, damit sie eine Chance im Buchhandel haben. Aber mit diesem Titel habe ich ein inhaltliches Problem. Fein ziseliert finde ich vieles überhaupt nicht, sondern eher grob gemeißelt, vor allem den Schluss. Kettly Mars ist eine routinierte Erzählerin, die einen bei der Stange halten kann, auch ihre Sprache ist schön. Aber dass sie allen unterschiedlichen Mitgliedern der Großfamilie einschließlich des Dienstpersonals die gleiche Stimme verleiht, irritiert mich doch sehr. Gleich zu Anfang spricht Alexandre, und ich finde es fast vermessen, sich in den Kopf eines Schizophrenen hineinzuversetzen. Ich erkenne die Absicht, das Tableau einer Familie zu zeigen, Alexandre dient nur als Folie.
■ TW: Was mich bei Kettly Mars fasziniert ist, dass sie, bedenkt man ihr Gesamtwerk, nie ausrechenbar ist, weniger routiniert als die jeweiligen „Grammatiken“ wechselnd, mit verschiedenen narrativen Ansätzen experimentierend, nicht rund und fertig und glatt ist. Das ist eine Qualität auch bei diesem Buch, das man vielleicht, ja, als Tableau mit Rissen und Sprüngen bezeichnen könnte.
■ KB: Was mir bei allen drei Romanen allerdings aufstößt ist, dass Frauenfiguren stark sexualisiert gezeigt werden. Bei Jeong und Nunn müssen junge, schöne Frauen sterben, um die Geschichte in Gang zu bringen, und bei Mars muss erst sexy Norah auftauchen, um der Familie wieder Leben einzuhauchen. Frauen sind entweder das junge Opfer oder das junge Luder. Sobald eine junge schöne Frau auftaucht bzw. stirbt, geht’s rund. Das ist leider oft so und nervt mich generell.
■ AD: Ja. „Sexy Norah“ z. B. befriedigt die sexuellen Bedürfnisse einer alternden Malerin, auch Tochter des Hauses … Für diese steht sie Modell gegen Bezahlung, es ist also ein Abhängigkeitsverhältnis. Die Familie ist zufrieden, hurra, es wird wieder gelebt! Das ist nicht fein ziseliert, da fehlen mir die Zwischen- und Grautöne.
■ TW: Grundsätzlich ist der Tod von „sexualisierten“ Frauen – wer sexy ist, stirbt oder ist böse – ein neuralgischer Punkt vieler Narrative: Wenn sexy Norah hier ein bisschen frischen Wind in den alten Laden bringt, stört mich das nicht sehr – „sexy“ ist ja nicht a priori eine schlimme Kategorie (außer sie wird von sabbernden alten Männern bemüht).
■ KB: Auffällig ist, dass auch Autorinnen und zwar aus allen Teilen der Welt diese Stereotype bedienen. Aber ich möchte damit die drei Romane, über die wir hier sprechen, nicht vom Tisch fegen. Sie erzählen ja viel mehr als nur das Eine. Bei Kettly Mars möchte ich auf dem „fein Ziselierten“ gerne beharren. Elegant finde ich auch, wie es ihr gelingt, die Geschichte einer inneren Entwicklung zu erzählen. Jedes der Familienmitglieder macht durch Alexandres Rückkehr und Norahs Auftauchen eine Wandlung durch. Äußerlich passiert wenig – Action geht anders! Gerade deshalb hat mich der Roman in Bann geschlagen.
Das Gespräch ist zuerst in den Litprom-„LiteraturNachrichten“ erschienen.
Die besprochenen Bücher:
Jeong Yu-jeong: Sieben Jahre Nacht. Aus dem Koreanischen von Kyong-Hae Flügel. Unionsverlag
Malla Nunn: Tal des Schweigens. Aus dem Englischen von Laudan & Szelinski. Ariadne und CulturBooks. Besprechung bei CulturMag
Kettly Mars: Ich bin am Leben. Aus dem Französischen von Ingeborg Schmutte. Litradukt











