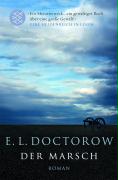 Spur der Verwüstung
Spur der Verwüstung
In seinem Roman Der Marsch zeichnet E. L. Doctorow ein komplexes Panorama des amerikanischen Bürgerkriegs, der eine neue nomadisierende Zivilisation hervorbrachte. Von Jörg Auberg
Als E. L. Doctorow an seinem Roman Der Marsch zu schreiben begann, gehörte er zu den prominenten Intellektuellen, die gegen den kommenden Irak-Krieg protestierten. In einem kurzen Essay aus dem Jahre 2004 warf er Präsident George W. Bush vor, gefühllos zu sein und nicht zu wissen, was Tod bedeute. Auch wenn er in seinem Roman über den Vernichtungsfeldzug des Generals William Tecumseh Sherman im Endstadium des amerikanischen Bürgerkriegs die aktuelle Katastrophe im Irak im Hinterkopf (mit der technologisch begünstigten Depersonalisierung des massenhaften Tötens und der „Einbettung“ der Presse in die militärische Maschine) gehabt haben mag, so ist Der Marsch doch kein Antikriegsroman, sondern eine komplexe, multiperspektivische, panoramische Beschreibung des Marsches als eine gewaltige und gewalttätige Transformationsmaschine, in der sich Shermans Armee nicht allein als omnivorer, zerstörerischer Tausendfüßler vom Herbst 1864 bis zum Frühjahr 1865 durch die Staaten Georgia, South und North Carolina bewegt, sondern auch die Zivilbevölkerung in eine nomadisierende, mobile, flüchtige Zivilisation verwandelt, die sich von der Vergangenheit lösen und in einer permanenten Drift den Veränderungen des Systems anpassen muss.
Primärziel Zerstörung
In erster Linie besteht Shermans Auftrag darin, soweit wie möglich ins Innere des Feindeslandes vorzudringen und den größtmöglichen Schaden an den kriegsentscheidenen „Ressourcen“ anzurichten. In der militärischen Praxis bedeutet dies einen modernen, totalen, durch den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt ermöglichten Krieg. Andererseits ist die militärische Kampagne in ihrer martialischen Zerstörung und ihrer Erbeutung des Landes und seiner Bewohner (vor allem der Frauen) archaisch. Shermans Primärziel ist die Zerstörung der konföderierten Produktivkräfte und der lokalen Ökonomien – vor allem in South Carolina, das Sherman als treibende Kraft der Sezession betrachtet und dem Boden gleich gemacht wird. Der Bürgerkrieg war zuvorderst ein Kampf zweier entgegengesetzter sozialer Systeme, wie der Journalist Karl Marx kurz nach Beginn des Krieges schrieb, und dieser Kampf konnte nur „durch den Sieg des einen oder des andern Systems“ beendet werden. Die Emanzipation der Afro-Amerikaner von der Sklaverei ist lediglich ein Nebenprodukt des militärischen Unternehmens. Viele Schwarze folgen Shermans Armee in den Norden, werden jedoch von der militärischen Führung als Ballast für den Feldzug betrachtet, sodass eine große Anzahl ohne den Schutz der Unionsarmee wieder den „Rebellen“ in die Hände fällt, erschossen oder erneut versklavt wird.
In der Tradition Dos Passos’
Um historische Figuren wie Sherman, Ulysses Grant, Abraham Lincoln und Kriegsminister Edwin Stanton erschafft Doctorow in der literarischen Tradition John Dos Passos‘ ein Ensemble vielschichtiger Charaktere in einer Matrix von Geographie und Zeit. Der aus Deutschland stammende Stabsarzt Wrede Sartorius, der eine Verachtung gegenüber dem „hierarchischen Kriegerunsinn“ hegt, dringt mit seinem „ungerührten Forscherblick“ in die menschlichen Überbleibsel der Gräuel; die Tochter eines Südstaaten-Richters geht ihm zeitweise als Krankenschwester zur Hand; einstige Repräsentanten der Südstaaten-Aristokratie verlieren nicht nur ihren Besitz, sondern auch ihren Verstand; Arly und Will, zwei Südstaaten-Deserteure, wechseln die System-Uniformen, um ihre Haut zu retten, bis sie schließlich ihr Leben verlieren; Pearl, eine junge Sklavin und illegitime Tochter eines weißen Plantagenbesitzers, versucht sich mit der Aussicht auf ein freies Leben mit dem weißen skeptischen New Yorker Wehrpflichtigen Stephen Walsh in den Norden durchzuschlagen. In einer beeindruckenden, nüchternen, von Sensationalismus und Sentimentalität unberührten Erzählökonomie gelingt es Doctorow, die Einzelschicksale in den Kontext geschichtlicher Erfahrung zu stellen und die Bedeutung dieses Krieges für die Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft in den Jahren danach begreifbar zu machen. Zeitgeschichtlich ist Der Marsch der Vorläufer von Doctorows früheren Werken Ragtime (1975) und Das Wasserwerk (1994): Im Laufe des Marsches finden die zukünftigen Eltern von Coalhouse Walker Jr. zueinander, dem schwarzen Musiker in Ragtime, der als Vergeltung für erlittenes Unrecht zum Militanten wird, während der Stabsarzt Sartorius in Das Wasserwerk zum genialischen, erkalteten Forscher mutiert, der die Menschen auf die biologische Materie reduziert. Erst nach und nach entsteht aus den Splittern der Erfahrung ein kohärentes Bild – vergleichbar mit jenem Prozess, „wenn sich eine Photographie im Entwicklungsbad abzuzeichnen beginnt“, wie ein zeitweise erblindeter Photographen-Assistent die Rückkehr seines Augenlichtes beschreibt.
An der Schnittstelle zwischen Moderne und Postmoderne
Mit seiner Technik der Vermischung von historischen Fakten und literarischer Imagination hat Doctorow regelmäßig Kritiker auf den Plan gerufen. Auch in diesem Roman operiert er an der Schnittstelle zwischen Moderne und Postmoderne und vermengt diskret Fakten und Fiktion. So lässt er beispielsweise Sherman, der seinen kleinen Sohn Willie verlor, an den Südstaaten-General William J. Hardee, der das gleiche Schicksal erlitt, einen Brief mit den Worten schreiben: „Wie unnatürlich ist doch dieses Zeitalter, in welchem die Seelen der Jungen, Gottes großartigem Strategem zuwider, vor denen der Alten den Körper verlassen.“ Zwar recherchierte Doctorow akribisch Militärstrategien und die chirurgische Praxis jener Zeit und zog auch Historiker zu Rate, doch griff er in diesem Fall zur Fiktion, da die historischen Zeugnisse Shermans (wie seine Briefe und Tagebücher) eine solche Erkenntnis nicht hergaben. Doctorows Intention war es, dass der Roman eine ähnliche Beziehung zur historischen Realität aufweisen sollte wie ein Van-Gogh-Gemälde zu einer realen Landschaft. Eine auf bloße Fakten- und Datenhuberei rekurrierende Abbildung geschichtlicher Episoden verstellt häufig eher die historische Erkenntnis als dass sie darunter liegende Erfahrungen offen legt.
Großartige literarische Leistung
Gravierender ist die fehlende Kritik der militärischen Organisation. Lediglich an Einzelfiguren wie dem triebgsteuerten Nordstaaten-General Kilpatrick, dem Kommandeur der „Kill-Kavallerie“, der den Süden als großen Markt zur Erfüllung seiner sexuellen Begierden betrachtet, zeichnet sich das Negative des militärischen Unternehmens ab, während die maßgeblichen Offiziere wie Sherman oder der Südstaaten-General Joseph Johnston als uniformierte Gentlemen auftreten, die sich von der Militärakademie oder aus den Schlachten des Mexikanischen Krieges kennen. Zum gegnerischen General Johnston hat Sherman mehr Vertrauen als zu seinen Vorgesetzten und „der ganzen intriganten Clique von Politikern in Washington“. In seinem „leftish anti-establishmentarianism“ (wie John Updike es nennt) lastet Doctorow die Schuld für die schlechte Realität klischeehaft den üblichen Verdächtigen, den politischen Rackets in Washington (vulgo „die da oben“), an, während er Shermans strategische Intelligenz bewundert, als sei die militärische Organisation nicht in hohem Maße, schon in der alltäglichen Routine, in die Praktiken der miserablen Gesellschaft verstrickt, wenn sie diese nicht gar potenziert. So greift auch eine Kritik zu kurz, die einem kriegsführenden Präsidenten „Gefühllosigkeit“ vorhält, ohne die übrigen Machteliten und Apparate mit auf die Rechnung zu nehmen. Dies freilich ändert nichts an Doctorows großartiger literarischer Leistung.
Jörg Auberg
E. L. Doctorow: Der Marsch. Aus dem Englischen von Angela Praesent. Kiepenheuer & Witsch 2007. Gebunden. 413 Seiten. 22,90 Euro.











