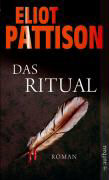 Mestizaje es grandeza…
Mestizaje es grandeza…
… zumindest ist das oft der Fall. Manchmal aber amalgamieren mehrere Subgenres in einem Roman aber nicht so recht. So wie bei Eliot Pattisons Das Ritual. Stellt Hans Richard Brittnacher bedauernd fest …
Die Vitalität des Krimis belegt nichts deutlicher als sein Vermögen, beständig neue Subgenres zu bilden – dazu zählen etwa der exotische, der historische und der Parallelgeschichts-Krimi: Im exotischen Krimi lässt ein europäischer oder amerikanischer Autor einen Helden in Sibirien, Konstantinopel oder im Tibet ermitteln und liefert dabei en passant Einblicke in die ungewöhnlichen Denkweisen und befremdlichen Verhaltensstandards anderer Welten. Im historischen Krimi wird ein Mordfall im antiken Rom, im England der Tudors oder im besetzten Frankreich des 2. Weltkrieges unter Berücksichtigung historischer Details und historischer Ermittlungsmethoden gelöst. Der Parallelgeschichtskrimi fragt nach den Möglichkeiten von Verbrechen und Aufklärung unter der Voraussetzung eines veränderten Geschichtsverlaufs, wenn etwa Stauffenbergs Attentat erfolgreich verlaufen oder die Deutschen den Krieg nicht verloren hätten – Robert Harris’ Vaterland ist das vielleicht bekannteste Beispiel.
Gleich drei Subgenres …
Mit seinem neuen Roman legt Eliot Pattison eine eher unbekömmliche Mischung dieser drei Subgeners vor – schade, denn mit seinen fünf Tibet-Krimis hatte sich Pattison einen guten Namen in der Welt des Kriminalromans erschrieben. Seine Bücher um den Inspektor Shan, einen in der Gunst der Pekinger Machthaber gestürzten Ermittler, dessen außerordentliche Fähigkeiten auch in einem Gulag für politische Gefangene im fernen Tibet gefragt sind, liefern nicht nur spannende und gut geschrieben Krimis, sondern verfolgen auch das Anliegen, dem ignoranten Westen den spirituellen Reichtum der tibetischen Kultur nahezubringen. Dieses Erfolgsrezept behält Pattison auch in seinem neuen Roman bei, aber verlagert es aus der geografischen in die historische Ferne: Sein Roman spielt im ausgehenden 18. Jahrhundert, zur Zeit der Besiedlung Nordamerikas. Den Part des begabten Ermittlers, der auf feindlichem Terrain mit großen Augen Zeuge der Geheimnisse einer fremden Kultur wird, nimmt hier der junge Schotte Duncan McCallum ein. Von den Engländern wegen Hochverrat zum Strafdienst in den neuen Kolonien verurteilt, zeigt er sich auf der Überfahrt als renitenter Häftling, dessen Hass auf die Englänger mit jeder Züchtigung zunimmt. Die Rettung einer über Bord gegangenen Wahnsinnigen und mehrere mysteriöse Mordfälle geben ihm Gelegenheit, nicht nur seine physische Widerstandsfähigkeit, sondern auch seinen analytischen Scharfsinn vorzuführen, hat er doch eine medizinische Ausbildung erhalten, die ihm bei der Obduktion der Mordopfer zugute kommt.
… Schamanen …
Im Zuge seiner Ermittlungen stößt er freilich auch auf einige schamanistische Kultgegenstände, deren Sinn ihm lange dunkel bleibt, schließt Freundschaft mit anderen Schotten und schwört, sich in der neuen Welt seiner Verpflichtung als einer der letzten der schottischen Clanführer würdig zu erweisen.
Seine Fähigkeiten aber führen auch dazu, dass sich sein Schicksal ändert – statt ruinösen Strafdienst zu leisten, soll er die Stelle eines ermordeten Schotten übernehmen und als Hauslehrer für die Kinder des englischen Landlords Ramsey verpflichtet werden, bemerkt aber schnell, dass er nur als Köder benützt wird, um seines Bruders habhaft zu werden, der sich in den Kämpfen zwischen Engländern und Franzosen offenbar auf die gegnerische Seite geschlagen hat. Allmählich beginnt auch der Held – ähnlich wie schon der Leser vor ihm – zwischen den vielen Kampf- und Schauplätzen eines Romans, der mal ein Krimi sein will und mal ein historischer Roman, die Orientierung zu verlieren: Die mit analytischem Scharfsinn durchgeführten Ermittlungen treten lange auf der Stelle und enden bei toten Zeugen und ominösen Kultgegenständen, die Konflikte beschränken sich nicht auf die zwischen Briten und Schotten, sondern auch innerhalb der Schotten bekämpfen sich Traditionalisten und Neuerer. Um sein eigenes Leben und das seines Freundes Lister zu retten, muss Duncan für die Engländer arbeiten und wird deshalb von seinen eigenen Landsleuten als Kollaborateur gemieden. Unter den verhassten Engländern wiederum gibt es zwar prügelnde Schinder, aber auch anständige Offiziere.
… und der Siebenjährige Krieg …
Der siebenjährige Krieg zwischen Engländern und Franzosen zieht in der Alten Welt die Schotten, in der Neuen die Indianer in Mitleidenschaft. Schon bei James Fenimore Cooper war in den Leatherstocking-Romanen zu lesen, dass sich die Kriegsparteien, unvertraut mit den Kampfbedingungen in der Wildnis, Bündnispartner bei den Indianer suchten – die Engländer bei den Irokesen, die Franzosen bei den Huronen. Hier nun webt Pattison zur endgültigen Desorientierung des Lesers die Überlegung ein, dass sich zwischen den Schotten und Irokesen eine besondere Beziehung bildete, die für den weiteren Gang der historischen Entwicklung folgenreich werden sollte, aber von der offiziellen Siedlungsgeschichte Amerikas totgeschwiegen wurde: Irokesen und Schotten stehen sich als freiheitsliebende Völker nahe; beide sind mit dem Leben in einer unwirtlichen Natur, die Schotten im Hochland, die Indianer in der Wildnis, vertraut; beide müssen für die Engländer, die sie eigentlich hassen, Kriegsdienst leisten, beide Völker befragen vor ihren Kämpfen Orakel, singen Lieder und tanzen Kriegstänze, beide pflegen intensiv ihre spirituellen Traditionen. Pattison ist offenbar vertraut mit neueren Ansätzen der Kulturtheorie, die den starren Antagonismus von Alter und Neuer Welt, von Orient und Okzident durch die Gedankenfigur des Dritten überwinden wollen, der Annahme einer Hybridisierung der Kultur, wie sie sich etwa in der Vermischung der amerikanischen Indianer mit den schottischen Hochlandkriegern abzeichnet. Das mag verdienstvoll sein, bekommt aber der Leserlichkeit des Romans nicht.
Ramsey, der neue Arbeitgeber Duncans, ist dabei, in den Kolonien gegen den Wunsch seiner Majestät, des englischen Königs, ein eigenes Reich zu errichten, was von der Allianz aus Schotten und Irokesen hintertrieben wird – dass Duncan, nicht nur ein forensischer Experte, sondern auch noch ein Perry Mason avant la lettre, den verhassten Ramsey bei einer Gerichtsverhandlung auch noch als Auftraggeber einer Serie von Morden entlarven kann, gerät in diesem Roman, der sich an seinen allzu vielen Voraussetzungen überhoben hat, fast in den Hintergrund. Die Figuren gewinnen kaum Leben, die angedeutete Liebesgeschichte zwischen Duncan und Sarah, der Tochter Ramseys, verkompliziert nicht nur weiter Duncans Situation, sie überzeugt nicht aus sich selbst, sondern scheint eher dem Hang zu fataler Vervollständigung des Romantorsos geschuldet, vor allem aber bleibt die Figur des Helden blass. Statt einen vitalen Bastard aus unterschiedlichen Subgenres zu kreieren, hat Pattison eher eine anämische literarische Chimäre ins Leben gerufen – die Ankündigung, ihr weitere Bände folgen zu lassen, kann allenfalls den Freund des historischen Romans erwartungsfroh stimmen.
Hans Richard Brittnacher
Eliot Pattison: Das Ritual (Bone Rattler, 2007). Roman. Deutsch von Thomas Haufschild. Berlin: Rütten Loening 2008. 542 Seiten. 19,95 Euro.











