
Die Heimkehr des Odysseus; aus Gustav Schwabs „Sagen des klassischen Altertums“ – siehe auch das CulturMag Klassik-Special
Suspense bei Homer – oder wie fing das Erzählen an?
Wieder zu entdecken: Erich Auerbach und seine „Narbe des Odysseus“ – von Alf Mayer.
„Die Welt ist für uns alle wahr
und für einen jeden verschieden.“ (Marcel Proust)
Ach Europa. Von den Rändern her sieht man es einfach besser. Die vielleicht beste Literaturgeschichte Europas – manche sagen sogar: „die“ – wurde im Exil in Istanbul geschrieben. Ihr Autor: der deutsche Jude Erich Auerbach, ein Freund Walter Benjamins. Auerbach gelangte 1936 mit Hilfe der aus der Schweiz operierenden „Notgemeinschaft deutscher Wissenschaftler im Ausland“ in die Türkei, so wie damals zahlreiche deutsche und österreichische Wissenschaftler, darunter der Ökonom Wilhelm Röpke oder Ernst Reuter, der spätere Bürgermeister von Berlin, der Philosoph Hans Reichenbach, der Musiker Paul Hindemith, der Architekt Bruno Taut oder die Architektin der „Frankfurter Küche“, Margarete Schütte-Lihotzky. (Der sehr schöne Dokumentarfilm „Haymatloz“ von Eren Önsöz beleuchtet dieses Zeit.)
Bis zur Weitermigration in die USA 1947 lehrte Auerbach für ein Jahrzehnt in Istanbul. Dort entstand auch sein Hauptwerk, „Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur“, 1946 in Bern bei Francke verlegt, heute in der neunten Auflage erhältlich und in fast 30 Sprachen übersetzt – bei uns viel zu wenig bekannt und beachtet.
Ausgerechnet in der Zeit des Nazi-Terrors, von 1942 bis 1945 entstanden, vergegenwärtigt „Mimesis“ sich in 19 essayistischen Kapiteln (später kam eines über Cervantes noch hinzu) der abendländischen Kulturgeschichte, wie unsere Literatur sie formte. Das Werk kommt gänzlich ohne Fußnoten aus, ist glänzend und packend geschrieben; später wies Auerbach gerne darauf hin, dass er sein Buch wohl nie vollendet hätte, wenn ihm eine westeuropäische Bibliothek mit all ihren Veröffentlichungen und Forschungsbefunden zur Verfügung gestanden hätte.
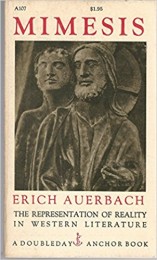
 Toskana um das Jahr 1300: Geburtsstunde des Realismus
Toskana um das Jahr 1300: Geburtsstunde des Realismus
Auerbach unternimmt nichts weniger als eine Neubestimmung des Realismus in der abendländischen Literatur, sein Angelpunkt ist Dante, der „jene Gestalt des Menschen“ fand, „die das europäische Bewusstsein besitzt“. Dante entschloss sich, statt im obligatorischen Latein in der Volkssprache, im toskanischen „volgare“, zu schreiben. Seinen Figuren legte er „all die markigen Worte und Redewendungen der Alltagssprach“ in den Mund, „nicht selten sogar auf eine derbe und ungestüme Weise“.
Für Auerbach war es eine Geburtsstunde des Realismus, Europa um das Jahr 1300: „All diese Frauen und Männer sind so frappierend real, so konkret, es gibt bei ihnen eine solche Übereinstimmung zwischen Geist, Körper und Verhalten, solch ein enges Verhältnis zwischen ihrem Charakter und ihrem Schicksal, dass die unverwechselbare Besonderheit eines jeden Individuums mit unvergleichlicher und oft auch ergreifender Kraft hervortritt.“ Und die Pointe: All diese Frauen und Männer bei Dante sind Tote! Seinen ersten großen Auftritt hat der moderne Individualismus in der Hölle.
 Auerbach als tiefsinniger Europäer
Auerbach als tiefsinniger Europäer
Erich Auerbach hat seinen Auftritt nun mit „Die Narbe des Odysseus“, Halbleinen, fadengeheftet, in einem idealtypischen Seitenspiegel, rundum begeisternd gediegen gestaltet und ausgestattet (von Antje Haack/ Lichten.com), zu seinem 60. Todestag am 13.10. 2017 im Verlag Berenberg erschienen und wie bei so vielen Büchern dieses Verlages einfach die helle Freude. Der Band mit Texten aus den Jahren 1922 bis 1957 will Auerbach einem größeren Publikum vorstellen, er enthält sechs Essays und gut zwei Dutzend Briefe, unter anderem an Walter Benjamin, Erwin Panofsky, Thomas Mann, Victor Klemperer, Siegfried Kracauer, Martin Buber, Karl Vossler. Kleine Vortexte geben je Hintergrund, das Buch insgesamt zeigt Auerbach als tiefsinnigen Europäer. Herausgeber Matthias Bormuth, Heisenberg-Professor für vergleichende Ideengeschichte am Institut für Philosophie der Universität Oldenburg, hat klug ausgewählt und steuert ein erhellendes Vorwort bei.

 Neben Dante ist es für Auerbach dann Montaigne, der „die Fülle der Freiheit“ auszuschöpfen weiß, der aus der „Gefangenschaft des Menschen in der Irdischkeit“ unzählige „Möglichkeiten macht, sich zu erproben: So also sieht das Ich aus … für sich, bei sich, mitten in der Welt, und ganz allein.“
Neben Dante ist es für Auerbach dann Montaigne, der „die Fülle der Freiheit“ auszuschöpfen weiß, der aus der „Gefangenschaft des Menschen in der Irdischkeit“ unzählige „Möglichkeiten macht, sich zu erproben: So also sieht das Ich aus … für sich, bei sich, mitten in der Welt, und ganz allein.“
Dieses Alleinsein, das Auerbach als Emigranten so sehr prägte, durchdringt er in seinem imaginären Dialog mit Montaigne: „Ich bin allein, ich muss sterben. Ich bin hier nicht zu Hause, ich bin auf der Reise, woher und wohin, das weiß ich nicht. Was habe ich, was bleibt mir? Ich selbst.“
Und an anderer Stelle, noch einmal: „Wem sein Heimatland lieb ist, der ist noch zu verwöhnt; wem jedes Land Heimat ist, der ist schon stark; wem aber die ganze Welt Fremde ist, der ist vollkommen.“
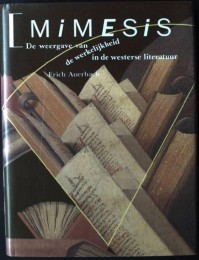
 Zentralstück des wunderbaren, schnell seinen recht schmalen Umfang vergessen machenden Buches ist der Essay „Die Narbe des Odysseus“ (welch einer schöner Titel), in dem unter anderem gefragt und danach auch begründet wird, was denn moderner sei: das Alte Testament oder Homers „Odyssee“?
Zentralstück des wunderbaren, schnell seinen recht schmalen Umfang vergessen machenden Buches ist der Essay „Die Narbe des Odysseus“ (welch einer schöner Titel), in dem unter anderem gefragt und danach auch begründet wird, was denn moderner sei: das Alte Testament oder Homers „Odyssee“?
Die unterschiedlichen Erzählhaltung(en), die Auerbach dabei herausarbeitet, sind jene, die dann die europäische Wirklichkeitsdarstellung geprägt haben: „Die Geschichten der Heiligen Schrift werben nicht, wie die Homers, um unsere Gunst, sie schmeicheln uns nicht, um uns zu gefallen und zu bezaubern – sie wollen uns unterwerfen, und wenn wir es verweigern, so sind wir Rebellen.“
Alf Mayer
Erich Auerbach: Die Narbe des Odysseus. Horizonte der Weltliteratur. Herausgegeben und eingeleitet von Matthias Bormuth. Berenberg Verlag, Hamburg 2017. Halbleinen, fadengeheftet. 176 Seiten, 22 Euro. Verlagsinformationen.
PS. Spannung bei Homer – hier aufgelöst
Eurykleia, Odysseus‘ alte Amme, meint sofort, als sie den an Penelopes Hof gekommenen fremden Bettler sieht, eine Ähnlichkeit zu Odysseus zu bemerken. Gewissheit gewinnt sie, als sie ihm die Füße wäscht und dabei eine Narbe über dem Knie ertastet, die sie zweifelsfrei wiedererkennt. Homer macht es spannend. Erst sagt er, dass Eurykleia die Narbe findet, dann aber nimmt er sich siebzig Verse Zeit, in denen er scheinbar umständlich und den Suspense ins Weite dehnend erzählt, wie Odysseus die Narbe bekam, ehe er den Spannungsbogen wieder aufnimmt, was nun denn wohl aus dem Inkognito des Heimkehrers werden wird.
Da trug die Alte die schimmernde Wanne
Zum Fußwaschen herbei; sie goß in die Wanne des Brunnen
Kaltes Wasser und mischt‘ es mit kochendem. Aber Odysseus
Setzte sich neben den Herd und wandte sich schnell in das Dunkel,
Denn es fiel ihm mit einmal aufs Herz, sie möchte beim Waschen
Seine Narben bemerken und sein Geheimnis verraten.
Jene kam, wusch ihren Herrn und erkannte die Narbe
Gleich, die ein Eber ihm einst mit weißem Zahne gehauen,
Als er an dem Parnaß Autolykos, seiner Mutter
Edlen Vater, besucht‘ und Autolykos‘ Söhne, des Klügsten
An Verstellung und Schwur! Hermeias selber gewährt‘ ihm
Diese Kunst; denn ihm verbrannt er der Lämmer und Zicklein
Lenden zum süßen Geruch, und huldreich schirmte der Gott ihn.
…
… Aber Odysseus
Faßte schnell mit der rechten Hand die Kehle der Alten,
Und mit der andern zog er sie näher heran und sagte:
Mütterchen, mache mich nicht unglücklich! Du hast mich an deiner
Brust gesäugt, und jetzo, nach vielen Todesgefahren,
Bin ich im zwanzigsten Jahre zur Heimat wiedergekehret.
Aber da du mich nun durch Gottes Fügung erkannt hast,
Halt es geheim, damit es im Hause keiner erfahre!
 Erich Auerbach: Die Unterbrechung, die gerade an der Stelle erfolgt, wo die Schaffnerin die Narbe erkennt, also im Augenblick der Krise, schildert die Entstehung der Narbe, einen Jagdunfall aus Odysseus ’ Jugendzeit, bei einer Eberjagd, als er zu Besuch bei seinem Großvater Autolykos weilte. Dies gibt zunächst Anlaß, den Leser über Autolykos zu unterrichten, über seinen Wohnort, die genaue Art der Verwandtschaft, seinen Charakter, und, ebenso ausführlich wie entzückend, über sein Benehmen nach der Geburt des Enkels; dann folgt der Besuch des zum Jüngling herangewachsenen Odysseus; die Begrüßung, das Gastmahl zum Empfang, Schlaf und Erwachen, der morgendliche Aufbruch zur Jagd, das Aufspüren des Tieres, der Kampf, die Verwundung Odysseus’ durch einen Hauer, das Verbinden der Wunde, die Genesung, die Rückkehr nach Ithaka, das besorgte Ausfragen der Eltern; alles wird erzählt, wiederum mit vollkommener, nichts im Dunkeln lassender Ausformung aller Dinge und aller sie verbindenden Glieder. Und dann erst kehrt der Erzähler in Penelopes Gemach zurück, und Eurykleia, die vor der Unterbrechung die Narbe erkannt hat, läßt erst jetzt, nach derselben, vor Schreck den hochgehobenen Fuß ins Becken zurückfallen.
Erich Auerbach: Die Unterbrechung, die gerade an der Stelle erfolgt, wo die Schaffnerin die Narbe erkennt, also im Augenblick der Krise, schildert die Entstehung der Narbe, einen Jagdunfall aus Odysseus ’ Jugendzeit, bei einer Eberjagd, als er zu Besuch bei seinem Großvater Autolykos weilte. Dies gibt zunächst Anlaß, den Leser über Autolykos zu unterrichten, über seinen Wohnort, die genaue Art der Verwandtschaft, seinen Charakter, und, ebenso ausführlich wie entzückend, über sein Benehmen nach der Geburt des Enkels; dann folgt der Besuch des zum Jüngling herangewachsenen Odysseus; die Begrüßung, das Gastmahl zum Empfang, Schlaf und Erwachen, der morgendliche Aufbruch zur Jagd, das Aufspüren des Tieres, der Kampf, die Verwundung Odysseus’ durch einen Hauer, das Verbinden der Wunde, die Genesung, die Rückkehr nach Ithaka, das besorgte Ausfragen der Eltern; alles wird erzählt, wiederum mit vollkommener, nichts im Dunkeln lassender Ausformung aller Dinge und aller sie verbindenden Glieder. Und dann erst kehrt der Erzähler in Penelopes Gemach zurück, und Eurykleia, die vor der Unterbrechung die Narbe erkannt hat, läßt erst jetzt, nach derselben, vor Schreck den hochgehobenen Fuß ins Becken zurückfallen.
Der für einen modernen Leser naheliegende Gedanke, es sei hier auf Erhöhung der Spannung abgesehen, ist, wo nicht ganz falsch, so doch jedenfalls nicht entscheidend zur Erklärung des homerischen Verfahrens. Denn das Element der, Spannung ist in den homerischen Gedichten nur sehr schwach; sie sind, in ihrem ganzen Stil, nicht darauf angelegt, den Leser oder Hörer in Atem zu halten. Dazu würde ja vor allem gehören, daß er durch das Mittel, welch es ihn «spannen» soll, nicht «entspannt» wird – und gerade dies geschieht sehr oft; auch in dem hier vorliegenden Falle geschieht es. Die breit erzählte, liebliche und subtil geformte Jagdgeschichte mit all ihrem eleganten Behagen, mit dem Reichtum ihrer idyllischen Bilder legt es darauf an, den Hörer ganz für sich zu gewinnen solange er sie hört – ihn vergessen zu lassen, was eben vorher bei der Fußwaschung geschah. Zu einem Einschub, der retardierend die Spannung erhöht, gehört, daß er nicht die Gegenwart ganz ausfüllt, daß er nicht die Krise, auf deren Lösung mit Spannung gewartet werden soll, dem Bewußtsein entfremdet und so auch die «gespannte» Stimmung zerstört; die Krise und die Spannung müssen erhalten, müssen im Hintergrund bewußt bleiben. Allein Homer, und darauf werden wir noch zurück zu kommen haben, kennt keinen Hintergrund. Was er erzählt, ist jeweils allein Gegenwart, und füllt Schauplatz und Bewußtsein ganz aus. So ist es auch hier.













