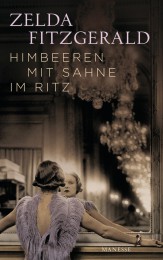Gin und Champagner
Elf Erzählungen der Autorin Zelda Fitzgerald gilt es in der fliederfarben gebundenen Ausgabe zu entdecken. Eine davon erschien postum – sie wurde erst in ihrem Nachlass entdeckt, Fitzgerald schrieb sie vermutlich während oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Die meisten der anderen Geschichten wurden unter dem Namen ihres Mannes abgedruckt, oder sie wurde lediglich als Co-Autorin genannt. Vermutlich, weil es dadurch mehr Geld für die Veröffentlichung gab. Möglicherweise spielte auch die Eitelkeit des zu diesem Zeitpunkt durchaus bekannten Schriftstellers F. Scott Fitzgerald für diese Entscheidung eine Rolle.
Zelda Fitzgerald beschreibt vor allem junge Frauen, die auf der Suche sind. Auf der Suche in einer Nachkriegsgesellschaft, einer Umbruchsgesellschaft während der Roaring Twenties. Geschlechterrollen verändern sich, Moralvorstellungen ebenso, und trotzdem bleibt den Frauen als höchstes Ziel, einen Mann zu finden, möglichst einen mit Geld und Ansehen.
Es gibt die typischen Frauenberufe wie Sekretärin, Verkäuferin, Gesellschafterin, doch dafür interessieren sich die beschriebenen jungen Damen nicht. Sie wollen das aufregende Leben. Als Tänzerin oder Schauspielerin, als Sängerin oder einfach als It-Girl, wie man heute sagen würde. Manche wollen dieses Leben, weil sie sich nach Anerkennung sehnen und sie rauswollen aus dem Kleinstadtmief, aus der Arbeiterklasse, weil sie eben nicht in diese Rollen, die die Gesellschaft vorgesehen hat, hineinpassen. Andere wollen es, weil sie dort ihre Talente sehen. Und auch sie wollen vor allem Anerkennung, von der sie nicht wissen, wie sie sie sonst bekommen sollen. Als Frau gibt es zu dieser Zeit noch nicht sehr viele andere Möglichkeiten, und vor allem auch kaum Rollenvorbilder.
Die Frauen bei Zelda Fitzgerald sind zornig, berechnend, sensibel, verloren, exzessiv, schüchtern, alles gleichzeitig. Sie sind nie leicht zu fassende Charaktere, nie voll und ganz sympathisch, aber immer dramatisch und tragisch. Fitzgerald führt sie liebevoll-ironisch vor, gibt sie der Lächerlichkeit preis, zeigt Mitleid und Verständnis, offenbart schließlich vor allem die Einsamkeit und den Schmerz ihrer Figuren.
Wenige finden ein versöhnliches Ende. Gracie, die „Leinwandkönigin“ aus der ersten Geschichte, die bereits 1925 erschien und damit die früheste ist, Gracie wird noch so etwas wie ein Happy End beschieden. Und auch das „Südstaatenmädchen“ findet nach einigen Irrungen Liebe, Ruhe und Erfüllung, hofft man jedenfalls. „Miss Ella“ hingegen hat ihre Träume und Hoffnungen auf die Liebe aufgegeben – ihre Hochzeit kam nicht zustande, weil kurz vor der Trauung der Ex-Verlobte auftauchte und sich an Ort und Stelle erschoss.
Die Künstlerinnen, die Fitzgerald beschreibt, kämpfen hart, nicht nur um den beruflichen Erfolg, sondern auch um die Anerkennung durch den jeweiligen Angebeteten. Das Verständnis für die Karriere der Frauen bleibt oft genug aus, und nicht nur hier sehen wir Parallelen zur Biographie Zelda Fitzgeralds.
Die Autorin entführt uns in diese ruhelose Zeit der 1920er Jahre, in der sie mit ihrem Ehemann zwischen den USA und Europa pendelte, so wie viele andere Amerikaner der besseren Gesellschaft, wie viele Künstlerinnen und Künstler es ebenfalls taten.
Die ständigen Partys, die dauernden Exzesse, die Liebesverwicklungen und Skandale – Fitzgerald transportiert mit wunderbaren Sprachbildern und pointierten Beschreibungen Lebensgefühl und Atmosphäre. Einige der Figuren haben deutlich ihr Vorbild in der Realität. Bei der Geschichte „Das Mädchen, das dem Prinzen gefiel“ denkt man unweigerlich an die Affären des späteren König Edward den Achten.
Halb- und Nebensätze genügen, und wir erfahren von der tiefen Kluft zwischen Arm und Reich, von den kulturellen Unterschieden der Nord- und Südstaaten, von Arbeiterklasse und gehobener Gesellschaft. Stets bleibt Fitzgerald ironisch und distanziert, keine Figur, keine Lebensweise ist vor ihrem subtilen Spott sicher, und doch sind die Geschichten durchweg charmant.
Die größten Katastrophen wie Abtreibung oder Selbstmord tippt sie nur an, fast geht sie darüber hinweg und lässt dadurch die Abgründe nur noch tiefer erscheinen. Der Tod der Revuetänzerin Grace klafft wie eine offene Wunde am Ende der Erzählung, eine Wunde, die sich so leicht nicht schließen lässt und noch lange schmerzen wird.
In der letzten Geschichte, „Andere Namen für Rosen“, in der ein tragisches Ehepaar an den falschen Orten nach Liebe sucht, wird die Protagonistin gefragt, wie es die Welt wohl geschafft hat, so lange durchzuhalten. Sie antwortet: „Gin und Champagner“. Die elf Geschichten schwimmen geradezu durch diese Getränke, und es liegt nahe zu vermuten, dass Fitzgerald damit auch eine Selbstaussage trifft.
„Gin und Champagner“ wäre ebenfalls ein guter Titel für den Erzählband gewesen. Nun heißt er „Himbeeren mit Sahne im Ritz“, ein Zitat aus der Geschichte „Die erste Revuetänzerin“, und eine Anspielung auf die wunderbare und zerstörerische Dekadenz der Roaring Twenties. „Himbeeren mit Sahne im Ritz“ ist ein hinreißendes und tragisches Buch, zart und brutal, so widersprüchlich wie die Zeit, in der die Geschichten entstanden. Und es ist das Zeugnis einer klugen, hochtalentierten Autorin.
(Zoë Beck)
Zelda Fitzgerald: Himbeeren mit Sahne im Ritz. Übersetzt von Eva Bonné. Manesse Verlag. 24,95€
Dieser Beitrag entstand ursprünglich für die Sendung Forum Buch/SWR2.