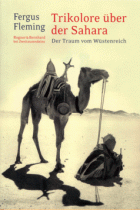 Schiere Existenz
Schiere Existenz
Belehren und Erfreuen sind immer noch keine schlechten Kriterien für Bücher. Fergus Flemings erzählendes Sachbuch über den Versuch der Franzosen, die Sahara zu kolonialisieren, erfüllt beide.
Erstens habe ich viel gelernt. Nämlich wie die Franzosen nach dem Einmarsch in Algier 1830 in einem grotesken Gemisch aus kolonialer Gier, blankem Größenwahn, bis an die Zähne bewaffneter Indolenz und administrativer und militärischer Inkompetenz sich die kontinentgroße Sahara fast zufällig und von Debakel zu Debakel einverleibt haben. Auf eine dumme Expedition folgte die nächste, auf eine militärische Katastrophe ein dürrer Pyrrhus-Sieg, auf ein Massaker die Vergeltung. Nach hundert Jahren und etlichen technologischen Innovationen – also Auto und Flugzeug – hatte man viel Sand, Fels und Gestein erobert, war mit dem christlichen Missionarseifer an den religiös desinteressierten Tuareg gescheitert, hatte den Traum einer Transahara-Bahn buchstäblich in den Sand gesetzt, hatte für ein paar Legionärsmythen von Ernst Jünger bis Friedrich Glauser gesorgt und ansonsten, wie es nunmal das historische Schicksal des Imperialismus ist, die stabilen Grundlagen für viel Ärger von heute gelegt.
Die Sahara als kontemplativer, ästhetischer und metaphysischer Ort wirkt als Faszinosum immer noch fort – als Ort der Erhabenheit, der moralischen (oder a-moralischen) Reinheit. Und als Manifestation des Naturschönen hat sie sich neben ihren funktionellen Vorläufern – dem Hochgebirge, der Südsee – in der kollektiven Wahrnehmung festgesetzt.
Bruder im Geiste
Wie das alles passieren konnte, das erzählt Fergus Fleming zweitens ungemein spannend und unterhaltsam. Er folgt nämlich mit leise sarkastischen Untertönen den Lebensläufen zweier entscheidender Protagonisten, die zur fatalen „Eroberung“ der Sahara beitrugen. Fürs Militärisch-Pragmatische ist dabei Henri Laperrine zuständig, ein staubtrockener, hocheffizienter Soldat und Absolvent der Militärakademie von St. Cyr, der die Kolonialarmee eher als Freiraum für den eigenen Ehrgeiz verstand denn als künstliches Paradies für die Freuden von kif und Absinth. Laperrine drillte sich eine eigene Truppe zäher Kamelreiter, die méharistes, die er aus Nomadenstämmen rekrutierte, die den Tuareg nicht unbedingt freundlich gegenüber standen, und machte sich daran, die Wüste mit einem Netzwerk aus kleinen Forts zu überziehen. Laperrine war klug genug, zu wissen, dass militärische Präsenz allein nicht ausreicht, die eher unscharf konturierten Ziele der französischen Kolonialpolitik umzusetzen. Deswegen suchte und fand er die Kooperation mit einem Bruder im Geiste:
Dem Vicomte Charles de Foucauld. Auch der war Soldat gewesen, hatte eine aufsehenerregende Expedition von Algerien durch die Wüste nach Marokko unternommen, allem Irdischen abgeschworen und wurde religiöser Schwarmgeist, resp. Asket und Eremit. Foucauld gab das typische Lotterleben nach den Maßgaben seiner Klasse im 19. Jahrhundert auf und wollte einen eigenen Orden gründen, der allerdings so strenge Regeln hatte, dass selbst die katholische Kirche abwinkte. Tatsächlich war Foucauld auch als Missionar nicht unbedingt erfolgreich – es gelang ihm zeitlebens nur, eine uralte, zudem blinde Frau zu taufen. Als Asket und eifriger Dauerbeter aber war er unschlagbar. Und er war ein fähiger und kundiger Kenner der Sahara und als Barfussmönch der ideale Geheimdienstmann.
Das, sein gutes standing bei den Tuareg, die ihn durchaus zu respektieren wussten als Quelle für Medikamente und Lebensmittel und als zähen Burschen, der sowohl ihre gesprochene Sprache (Tamasheq) sprach und ihre geschriebene Sprache (Tinifar) lexikalisierte, sowie seine kumpelhafte Beziehung als geistiger Seelentröster und Beichtvater für die französischen Besatzungssoldaten in ihren einsamen Posten, machten ihn für Laperrine zum idealen Verbindungsmann. Foucauld wusste alles, was sich in der Wüste zutrug, seine heftige Korrespondenz mit Frankreich war propagandistisch wertvoll, wenn man erstmal seine kruden religiösen Schwärmereien in Abzug brachte.
Eine riesige Fläche aus Sand und Fels
Laperrines Plan, die gesamte französische Einflusssphäre vom Atlantik bis zum Niger im Süden und nach Khartoum im Osten infrastrukturell zu vereinigen – christlich und französisch -, war der Lebensmotor dieser beiden Figuren.
All das ist, wir wissen es, gescheitert. Foucauld wurde 1916 von marodierenden Arabern eher jämmerlich, denn grandios ermordet und Laperinne kam 1920 in der Wüste um, nachdem sein Flugzeug während einer extrem dümmlichen Prestige-Aktion abgestürzt war.
Die Sahara, schreibt Fleming am Ende des Buches, blieb auch nach dem Tod der beiden Männer unverändert: „eine riesige Fläche aus Sand und Fels, in der sich nichts radikal wandelt und in der nichts einen bleibenden Eindruck hinterließ.“ Schon gar nicht Schwert und Kreuz.
Mythen und Legenden sind zwar langlebig – Flemings Buch erzählt sie grandios -, und vermutlich auch für den geistigen Haushalt von homo sapiens überlebensnotwendig. Angesichts der schieren Existenz der Sahara aber sehr, sehr begrenzte Veranstaltungen.
Thomas Wörtche
Fergus Fleming: Trikolore über der Sahara. Der Traum vom Wüstenreich (The Sword and the Cross, 2003). Dt. von Bernd Rullkötter. Hamburg: Rogner & Bernard bei Zweitausendeins, 2004, 399 Seiten











