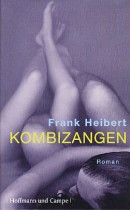 Mit geöltem Gewinde
Mit geöltem Gewinde
„Kombizangen“ ist ein Beziehungsroman, ein Berlinroman und noch vieles mehr. Angesiedelt im Berlin des Jahres 1995, in einer Stadt im Um- und Aufbruch, bietet der Roman zahlreiche Möglichkeiten, dem merkwürdigen Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit nachzuspüren.
Frank Heibert ist in der Literaturszene alles andere als ein Unbekannter. Allein bei Amazon.de finden sich 38 Bücher, wenn man nach seinem Namen sucht. Als Übersetzer von Don de Lillo, Richard Ford, Boris Vian, Yasmina Reza und vielen anderen ist der 1960 in Essen geborene Heibert ein alter Hase im Literaturgeschäft. Er übersetzt aus dem Englischen, Französischen, Spanischen, Portugiesischen und Italienischen Romane, Erzählungen, Theaterstücke und bisweilen auch Sachbücher, leitete außerdem einige Jahre mit Thomas Brovot den zebra Literaturverlag. Nun hat er mit Kombizangen den ersten eigenen Roman vorgelegt.
Die langjährige intensive Arbeit an fremden Texten hat Heiberts Gespür für Tonfälle, vor allem für Dialoge geschärft. Hier sitzt jeder Satz und Halbsatz, Timing und Tempo sind richtig gewählt. Man könnte höchstens sagen, dass der Roman an manchen Stellen ein wenig zu glatt läuft, der Grenze zum Trivialen das ein oder andere Mal gefährlich nahe kommt.
Eskalation einer „Nichtbeziehung“
Erzählt werden in vier Episoden die Geschichten von vier Mittdreißigern, die Erzählperspektive wird dabei von Episode zu Episode wie ein Staffelstab von den jeweiligen Hauptfiguren weitergereicht. Da ist zunächst Alexander, der in seiner virtuellen Welt, die er als Computerspielentwickler erschafft, besser zurechtkommt als in der Realität. Die geheimnisvolle Julia hat es ihm angetan, die er eines Tages zufällig bei einer Wohnungsbesichtigung trifft. Er ist sich ziemlich sicher, dass er vor vielen Jahren etwas mit ihrer Mutter hatte. Er beschließt, sie zu beobachten, und findet heraus, dass es ihre Masche ist, auf Wohnungsbesichtigungen Makler und Eigentümer zu becircen, um eine Probenacht in der entsprechenden Wohnung zu verbringen (mal mit, meistens jedoch ohne Begleitung).
Alexander wird in seinem Beobachtungszwang immer manischer, wird zu einem regelrechten Stalker. Dennoch kommt es zu einem sehr kurzfristigen Verhältnis zwischen den beiden. Als Julia versucht, Alexander wieder loszuwerden, offenbart er seine dunkle Seite. Mit dem Wissen, das er im Laufe seiner Beschattungen über sie gesammelt hat, beginnt er, ihre berufliche Karriere zu zerstören und Geister ihrer privaten Vergangenheit zu wecken. Halt findet Julia bei Bernie, einem schwulen Architekten, der jedoch dem körperlichen Kontakt zu Frauen nicht gänzlich abgeneigt ist. Ihre „Nichtbeziehung“, die beiden ermöglicht, die Augen nach Sexualpartnern offen zu halten, funktioniert eine Weile recht gut, eskaliert jedoch an dem Ort, der für viele Paare zum Prüfstein wird: bei IKEA. Dass Bernie an diesem Tag auf einer Baustelle von einem Arbeiter bereits als Schwuchtel beschimpft wurde, sorgt bei ihm für ein empfindliches Nervenkostüm, das zerbricht, als Julia ihn mit diesem seltsamen Blick als „idealen Vater“ bezeichnet. An diesem Tag, dem 14. September 1995, beschließt Bernie, seinen Vertrag mit der Welt aufzukündigen – Schluss mit lustig, Schluss mit nett. Bernie nimmt Rache, indem er den Bauarbeiter entführt.
Zwischen „U“- und „E“-Literatur
In Kombizangen sind die Schicksale der vier Protagonisten auf vielfache Weise miteinander verbunden, ohne dass diese selbst davon wüssten. Inmitten der pulsierenden Großstadt ist jeder der Vier mit einer inneren Einsamkeit geschlagen, jeder versucht, den anderen in die Zange zu nehmen, ohne zunächst die eigenen Gefühle in den Griff zu bekommen. Heibert lässt alltägliche Situationen eskalieren, ohne hierbei zu übertreiben. Bei allem Humor bleiben die Schicksale tragisch, geraten nicht zur Groteske. Dass Heibert hier selbst das mit Klischees verminte Gelände IKEA nicht ausspart, die Herausforderung der Schmonzettengefahr annimmt, ist ein großes Wagnis in der deutschsprachigen Literatur. Vermutlich sind es seine Erfahrungen als Übersetzer, die ihn die Gräben zwischen Unterhaltungsliteratur und ernster Literatur so leichtfüßig überspringen lassen. Höchstens Thommie Bayer kann man eine ähnliche Meisterschaft auf diesem Terrain zusprechen. Mit diesem verbindet Heibert übrigens noch eine ganz andere Eigenschaft: die Musik. Als Sänger ist er bereits seit 1998 in wechselnden Jazz-Formationen aktiv. Aktuell hat er mit „Finkophon Unlimited“ die CD The best thing on your feet aufgenommen – mit Songs, die vom Roman inspiriert sind, die sozusagen den Soundtrack zum Buch bilden. Mit angenehmer Stimme und spannenden Arrangements groovt und swingt sich Heibert, begleitet von Thomas Finke am Klavier, Roland Fidezius am Kontrabass und Beni Reimann an den Percussions, durch das Buch. Die Musik zum Roman ist ein heißer Tipp.
Frank Schorneck
Frank Heibert: Kombizangen. Hoffmann und Campe 2006. 443 Seiten. 22,00 Euro.











