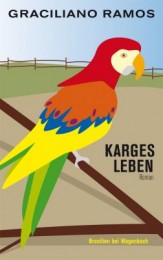 Ein Leben mit zyklischen Dürrekatastrophen
Ein Leben mit zyklischen Dürrekatastrophen
– In kurzen, beinahe autonomen, psychologisch dichten Momentaufnahmen schildert Graciliano Ramos (1892–1953) in „Karges Leben“ (ursprünglich 1938 erschienen) die Geschichte einer mittellosen Landarbeiterfamilie im brasilianischen „Sertão“, jener semi-ariden Zone, die ihren Bewohnern durch die periodisch auftretenden Dürren das Leben zur Hölle macht. „Karges Leben“, ein Klassiker der brasilianischen Literatur, wurde anlässlich der diesjährigen Frankfurter Buchmesse mit dem Ehrengast Brasilien neu aufgelegt und zwar in Willy Kellers zeitloser Übersetzung von 1966. Doris Wieser hat das Buch gelesen.
Graciliano Ramos erzählt vom Überlebenskampf von Menschen in extremen geographisch-klimatischen Bedingungen. Fabiano, Sinhá Vitória, ihre beiden namenlosen Kinder und zwei Haustiere (ein Papagei und eine Hündin) sind auf der Flucht vor der Dürre. Es fehlt ihnen an allem: Nahrung, Kleidung, einem Dach überm Kopf und einem Stück Land, das sie bestellen könnten. Ihren Papagei müssen sie an einem besonders kritischen Tag aufessen. Die Hündin Baleia, ein wahrhaft vollwertiges Familienmitglied, bleibt verschont – vorerst.
Sprachlosigkeit
Die vom Mangel gekennzeichneten äußeren Lebensbedingungen begleiten die Familie auch in ihrem Inneren, denn die Kargheit der Landschaft spiegelt sich in der bildungsbedingten Kargheit der Sprache der Figuren wider. Es fehlt ihnen schlicht und ergreifend an Vokabular. Da die Eltern mit ihren Kindern kaum sprechen, bleibt deren Ausdrucksfähigkeit rudimentär und sie ahmen ersatzweise die Laute der Tiere nach. Auch Vater Fabiano macht in schwierigen Situationen von dieser Technik Gebrauch und grunzt und blökt vor sich hin. Vor allem er als Familienoberhaupt, gerät immer wieder in Konflikte, in denen ihm die Worte für das, was er erlebt und fühlt, fehlen.
So erweist sich nicht nur das Land als Feind der Familie, aufgrund seiner praktisch inexistenten Bildung, kann Fabiano vieles nicht verstehen und sich gegen erfahrenes Unrecht kaum zur Wehr setzen. Permanentes Misstrauen beherrscht sein Handeln. Er glaubt, dass ihn alle Menschen übervorteilen wollen (Händler auf dem Markt, ein Soldat, sein Dienstherr), kann aber das ihm widerfahrene Unrecht nicht nachweisen, da es ihm nicht gelingt, eine logische Argumentationskette aufzubauen. Dennoch verfügt er über ein gesundes Gespür für Gerechtigkeit. Fabiano weiß, er steht ganz unten, so weit unten, dass alle leichterdings auf ihn herabtreten und ihm auch noch das Letzte nehmen können, auch wenn das alles andere als „gerecht“ ist. Seine Hilf- und Sprachlosigkeit wachsen sich daher zu einer echten Behinderung aus.
Immer wieder gerät er in Situationen, die aus seiner Innenperspektive gesehen geradezu kafkaesk wirken. Fabiano jedoch fehlt es an einem Minimum an Bildung, die ihm erlauben würde, bestimmte Dinge selbst zu verändern, vorauszudenken, Strategien zu entwickeln. Sogar die simpelsten Gedankengänge seiner Frau erstaunen ihn zutiefst. Wenn diese etwa behauptet „Die Tauben töten das Vieh“, kann er nur mit größter Anstrengung den dahinterliegenden Gedankengang entschlüsseln: „Die wilden Tauben trinken das Wasser aus. Richtig. Das Vieh muß Durst leiden und stirbt. Sehr richtig. Die wilden Tauben töten das Vieh. Ganz genau“ (118).
Mensch oder Tier
Das Fehlen einer „menschlichen“ Sprache wirft Fabiano und vor allem seine beiden Söhne immer wieder auf die Kondition von Tieren zurück. Gleichzeitig steigt die Hündin Baleia in den Rang eines Menschen auf, da sie das bittere Leben und all seine Entbehrungen mit den anderen Familienmitgliedern teilt. Ihre Vermenschlichung wird an den Stellen besonders plastisch, an denen die Erzählerstimme der Hündin ähnliche Gedanken und Gefühle zuschreibt wie den menschlichen Figuren. Besonders markant ist dieses Verfahren im Kapitel „Baleia“, in dem sich Fabiano genötigt fühlt, die mittlerweile erkrankte Hündin zu töten. Dass er sogar dabei versagt, zeigt der Ausschnitt aus der Verfilmung von 1963 unter der Regie von Nelson Pereira dos Santos.
Rohheit
Fabianos Unvermögen sich zu wehren, seine erdrückende Machtlosigkeit, sein täglicher Kampf um ein Minimum an Selbstwertgefühl, kanalisieren sich in Gewaltausbrüchen. Er ist seinen Impulsen und Instinkten ausgeliefert, trinkt sich den Frust oft mit Zuckerrohrschnaps weg und kann die Folgen seiner Handlungen kaum abschätzen. Nur ein Gefühl vermag ihm Einhalt zu gewähren: das Gefühl der Angst. Die Angst vor den unabwägbaren Konsequenzen bremst ihn im letzten Augenblick und verhindert, dass der eine erfahrene Demütigung durch einen Mord rächt. Seine und Sinhá Vitórias Rohheit zeigt sich auch in ihrem Umgang mit den Kindern. Es fehlt ihnen jegliche Zärtlichkeit, jegliches Einfühlungsvermögen. Die unschuldigen Fragen der Kleinen, die die Ignoranz der Erwachsenen augenfällig werden lassen, bestrafen sie mit Schlägen. Aber auch wenn die Kinder still sind, lassen die Erwachsenen ihre Wut, ihre Verzweiflung, ihre Hilflosigkeit allzu oft an den ihnen aus. Gegenseitige Unterstützung leisten sie nur in Ansätzen, denn dazu fehlt ihnen die Kraft.
Wenn Graciliano Ramos einerseits soziale Missstände wie die Willkür der Obrigkeit den nomadischen Landarbeitern gegenüber und die Verrohung dieser aufgrund mangelnder Bildung und harter Lebensbedingungen bloßstellt, so wirft er trotzdem keinen mitleidvollen Blick auf die Opfer einer sozio-ökonomischen Situation. Sein karger Blick auf eine immer noch virulente Realität beschönigt nichts und entschuldigt nichts, weder die ausbeuterische Grobheit der ökonomisch Stärkeren noch die Lieblosigkeit und Gewalttätigkeit der Schwachen. Er zeigt einfach nur Stationen eines absolut basalen Überlebenskampfes, in dem Mensch und Tier gleichgestellt sind.
„Karges Leben“ ist ein schmales Büchlein das durch seine eindringliche Darstellung von Gewalt, Schmerz und Hoffnungslosigkeit berührt und durch seine außergewöhnliche poetische Kraft und stilsichere Ruhe betört. Sein sezierender, schonungsloser Blick auf die kleinen Verletzungen, die – weil sie nicht versorgt werden – zu lebensbedrohlichen Wunden heranwachsen, körperlich und seelisch, macht aus dem Klassiker des brasilianischen Regionalismus ein kurzweiliges und absolut universelles Werk.
Regionalismus
Graciliano Ramos, geboren in Quebrangulo im Bundesstaat Alagoas, gehört zu den tonangebenden Stimmen des brasilianischen Regionalismus, der im Laufe der 1930er Jahre im Zuge der Neuerungsbewegungen des Modernismus entstand und sich die kulturelle Aufwertung jener abseits der großen urbanen Zentren liegenden Gegenden zum Programm gemacht hat. Gilberto Freyre beharrte in seinem „Regionalistischen Manifest“ von 1926 darauf, dass die soziokulturellen Elemente der kolonialen Vergangenheit, das heißt insbesondere das in den Zuckerrohrplantagen der Sklavenhaltergesellschaft entstandene Patriarchat mit seinem spezifischen Habitus hinsichtlich Kleidung, Gastronomie, Soziabilität etc. das wahre, „authentische“ Brasilien verkörpere, wohingegen die in neuerer Zeit aus Europa importierten Ideen (Republikanismus, Liberalismus) der brasilianischen Lebensweise zuwider laufen würden. Dass die Vergangenheit, die er beschwor, nicht minder von europäischem Gedankengut geprägt war, lässt der Soziologe dabei taktisch außen vor, denn so gelingt es ihm, den Regionalismus in Opposition zum in den 1920er Jahren in São Paulo entstandenen Modernismo zu setzen. Beiden Bewegungen ging es jedoch im Prinzip um dasselbe, wenn sich auch die Mittel unterscheiden: die Suche nach der „brasilidade“, der brasilianischen Identität. Diese werde laut Freyre in besonderem Maße vom Nordosten des Landes verkörpert.
Doris Wieser
Graciliano Ramos: Karges Leben (Vidas Secas, 1938). Aus dem brasilianischen Portugiesisch von Willy Keller. Berlin: Wagenbach 2013. 140 Seiten. 9,90 Euro. Quelle des Bildes: Homepage des Autors.













