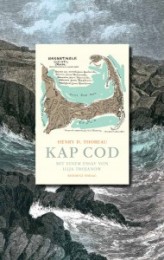 Der ideale Reisebericht
Der ideale Reisebericht
– Henry D. Thoreau auf „Kap Cod“ – von Alf Mayer.
Er sähe nicht ein, warum er nicht genauso gut ein Buch über Kap Cod schreiben sollte wie sein Nachbar eines über „Menschliche Kultur“. Es sei nur ein anderer Name für die dieselbe Sache und wohl kaum der sandigere Teil davon. Jener Nachbar war Ralph Waldo Emerson, als Buch erschienen die Betrachtungen von Henry D. Thoreau über Cape Cod erst drei Jahre nach seinem Tod; 1865, in einer Auflage von 2000 Exemplaren. Der österreichische Residenz Verlag hat nun, von Klaus Bonn besorgt und mit einem überschaubaren Anmerkungsapparat sinnvoll ergänzt, eine schöne Neuübersetzung herausgebracht. Klaus Bonn hat zudem, dies kein geringer Verdienst, die Texte mit den Notaten zu dessen letztem Besuch auf dem Kap aus dem Tagebuch Thoreaus ergänzt. Sie waren bisher weder in der der amerikanischen Erstausgabe noch der textkritischen, 1988 von Joseph J. Moldenhauer herausgegebenen Edition enthalten.
Insgesamt vier Mal ist Henry David Thoreau zwischen 1849 und 1857 auf das Kap gereist, das Buch macht daraus einen einzigen Wandergang und ist all dem mindestens ebenbürtig, was er über das Inland schrieb (etwa „Die Wildnis von Maine“, deutsch 2012 bei Jung und Jung). Unterteilt ist diese Landvermessung in zehn Kapitel, beginnend mit „Das Schiffswrack“ (dazu weiter unten mehr) und „Beobachtungen aus der Postkutsche“, zweimal explizit „Der Strand“. Es gibt den „Austernhändler von Wellfleet“, einen Ausflug zum „Hochland-Leuchtturm“ und eine weitreichende Betrachtung über „Das Meer und die Wüste“. Angelegt waren die Berichte ursprünglich als Vorträge und als Magazinserie in „Putnam’s Monthly Magazine“, ihre Buchform erhielten sie nach Thoreaus Tod durch seine Schwester Sophia und den zweimaligen Kap-Cod-Reisegefährten Ellery Channing.
Um es gleich zu sagen: „Kap Cod“ ist weit mehr als ein Reisebuch, es elektrisiert auf vielerlei Ebene und ist in keiner Weise veraltet. Schnell verflog mir mein Befremden über die seltsame Eindeutschung von „Cape Cod“ als Kap Cod, was immer Übersetzer und Verlag zu dieser antiquierten Schreibweise gebracht haben mag. Die Tatsache, dass dieses fundamentale Werk nun in dieser schönen Form zugänglich ist, überwiegt auch den Kritikpunkt, dass eine detaillierte Karte der Halbinsel fehlt. Die alte Kartenzeichnung auf dem Umschlag macht immerhin die seltsame Tomahawk-Form dieser Landvorlagerung an der Küste von Massachusetts anschaulich, hier ein Link auf eine von Thoreau selbst gezeichnete Karte.
 Ein Strandläufer: Blick aus tausend Augen
Ein Strandläufer: Blick aus tausend Augen
Zu seinen mehr oder weniger ausgeübten Berufen gehörte auch Landvermesser. „Wer einen Beruf ergreift, ist verloren“, bemerkt er in „Walden“. Seine in „Kap Cod“ eingesetzten Instrumente sind freilich vielfältiger als die Werkzeuge für Höhen- und Entfernungsbestimmung. Thoreau schürft im Wurzelwerk, in der Bedeutung von Worten ebenso wie in der Vergangenheit, sei es die erd- oder die menschengeschichtliche. Ihn interessiert die weiße Besiedlung und die Landstehlerei von den Ureinwohnern – er arbeitete längere Jahre an einer nie vollendeten Studie über die Indianer Nordamerikas, hatte dazu tausende Seiten Notizen und Extrakte verfertigt, 1861 dazu auch die Lower Sioux Agency in Redwood, Minnesota, besucht – ebenso wie jede Besonderheit dieses Küstenstreifens. Er sinniert über Pflanzen, Tiere, Menschen, Austernhändler und Kabeljaufischer, Strandhafer und die seltsam niedrigen Obstgärten; seine Aufmerksamkeit reicht vom kleinen bis winzigen Meeres- und Sandgetier zu den Geschöpfen der Luft und zum Treibholz und anderem Strandgut; er erzählt aus den besonders gut dokumentierten Kirchenbüchern. Siedlerväter stehen bei ihm neben Indianerpriestern, Schnecken, Riesentrogmuscheln und Schwämme neben Schiffswracks. Der auf Kap Cod einst ausgeprägte Walfang, von dem noch ganze Gartenzäune aus Knochen künden, ist ihm ebenso Gegenstand wie die Methode der Indianer, Möwen zu fangen, oder die Herkunft der Worte „Schooner“ und „übertölpeln“.
Thoreau ist ein Strandläufer von literarischen Graden – seinem „heroischen“ Stil und der Tiefe seines Ausdrucks widmet sich eine weitere aktuelle Neuerscheinung, nämlich Stanley Cavells „Die Sinne von Walden“ (dazu unten etwas mehr). Vor allem aber ist Thoreau Philosoph. Hier, am Meeresrand, an rauer Küste, findet er Fundamentales. Er, einer der vornehmsten Vertreter des neuidealistischen amerikanischen Transzendentalismus, der auch Herman Melville und Walt Whitman beeinflusste, macht aus seiner Küstenwanderung tatsächlich ein Werk über die „Menschliche Natur“. Die Wikipedia-Definition der Transzendentalisten („traten für eine freiheitliche, selbstverantwortliche und naturzugewandte Lebensführung ein“) lässt anklingen, warum Thoreau aktuell ist.
 Über das Verschwinden des Mitleids
Über das Verschwinden des Mitleids
Der Weg, den er auf der Strecke das Kap entlang bis Provincetown – real ebenso mäandernd wie in der Niederschrift – zurücklegt, ist auch eine spirituelle Reise, ist eine Suche nach Verborgenem, nach Schätzen der materiellen wie der immateriellen Welt – kurzum nach Sinn. Er hat „nicht die Absicht, eine sentimentale Exkursion zu unternehmen“.
Bereits im ersten Kapitel, „Das Schiffswrack“ betitelt, sind wir bei Leben und Tod. Berufenere haben herausgearbeitet, wie viel das mit dem frühen Tod seines älteren Bruder John zu tun hat. Siehe etwa Sharon Purvis Talleys „Thoreau’s Journey to Cape Cod: A Psychohistorical Perspective“. (Zum PDF geht es hier)
Seine erste Reise ans Kap im Oktober 1849 geschah in den Tagen eines großen Schiffbruchs. Zwei Tage, nachdem die St. John aus Galway auf einem Felsstreifen vor Cohasset zerschellte und über einhundert Leichen an Land gespült wurden, waren er und sein Begleiter Zeuge, wie die teils zerschundenen Leichname der vor der heimatlichen Hungersnot fliehenden Familien geborgen und in Särge gepackt wurden, viele Kinder darunter. Als wäre es ein heutiges Mediengesetz, stellt er fest:
„Insgesamt war die Szene nicht so beeindruckend, wie ich das erwartet hätte. Wenn ich eine einzelne, an den Strand geschwemmte Leiche gefunden hätte, würde mich das stärker bewegt haben. Ich fühlte mehr mit den Winden und Wogen, als ob das Hin- und Herschleudern und Verstümmeln dieser armen menschlichen Körper an der Tagesordnung wäre. Wenn dies das Gesetz der Natur war, warum sollte man dann die Zeit mit Ehrfurcht und Mitleid verschwenden?“
Und er fährt fort: „Ich sah, dass Kadaver vervielfacht werden können wie auf einem Schlachtfeld, bis sie uns in keiner Weise mehr als Ausnahmen des allgemeinen Schicksals der Menschheit berühren. Es ist das Einzelne und das Persönliche, das nach unserem Mitgefühl verlangt.“
Alleine dieses erste Kapitel ist ein Solitär. Annie Proulx und ihre „Schiffsnachrichten“ wären wohl ohne „Kap Cod“ nicht denkbar, Thoreau und seine Betrachtungsweise(n) haben einen lange strahlenden Einfluss. Das nächste Kapitel „Beobachtungen aus der Postkutsche“ verwirft eben diese passive Perspektive als oberflächlich, summiert darunter auch das Sich-Bildermachen aus anderen Quellen, ermuntert zum eigenen Blick, zur eigenen Anschauung – der, welch ein schönes Bild – durchaus mal der Wind ins Gesicht blasen müsse. Wer beim Wandern vielleicht schon selbst die Wärme jenes inneren Trotzes gespürt hat, gegen den Regen anzustapfen und gegen die Monotonie, vermag solchen Sätzen wie den nachfolgenden wohl besonders zu folgen „Jede Landschaft, die trostlos genug ist, hat in meinen Augen eine gewisse Schönheit.“
Wind und Regen im Gesicht
Thoreaus Augen unterscheiden Erde von Sand, die Gischt von den Wellen, die Pechblende vom Gold, seine Ohren lauschen dem, wie das Meer bei Homer gerauscht haben mag. Die Griechen hatten viele Worte für das Getöse des Meeres, bei Aischylos war es „die mannigfach erschallende See“, bei Homer „die weit aufrauschende See“, in der Übersetzung von Voß „die Gewalt des Stromes Okeanis“. Bei allem Salz in der Luft und seiner philosophischen Würze aber kommt der Moment, wo solch ein Blick abstumpft. „Als wir von der Meeresküste zurückgekommen sind, haben wir uns manchmal selbst gefragt, warum wir nicht mehr Zeit damit verbracht haben, das Meer zu betrachten; aber bald schon schaut der Reisende nicht mehr zum Meer als zum Himmel.“ Tage danach noch freilich vermag er „das Getöse des Meeres zu vernehmen, als ob ich in einer Muschel lebte“.
All den „Ab in den Urlaub“-Pauschalisten, die durchgehenden Sonnenschein im All-inklusive-Paket verlangen, schreibt das Buch die Schönheiten des schlechten Wetters ins Stammbuch. Thoreaus liebste Jahreszeit am Meer wäre der Herbst. „Ein Sturm ist die rechte Zeit für einen Besuch, ein Leuchtturm oder eine Fischerhütte das wahre Hotel.“ Der letzte Satz über Kap Cod lautet: „Ein Mensch mag dort stehen und ganz Amerika hinter sich lassen.“
 Nachbemerkungen
Nachbemerkungen
Ilija Trojanow hat das Buch mit einem Vorwort versehen (nachzulesen hier), es enthält eine hübsche Anekdote. Gleich am Beginn seiner Fahrt auf das Kap wird er von der Polizei angehalten, er sei zu schnell gefahren. Wer er denn sei und was er wolle? Kap Cod auf den Spuren Thoreaus besuchen, sagt er. Warum er es denn dann so eilig habe, antwortet der Polizist. Hartgesottenen Wanderern, die an Thoreaus Route interessiert sind, sei der Reisebericht von Eric D. Lehman empfohlen: Walking Cape Cod with Thoreau.
Hingewiesen sei auf zwei weitere Bücher. In „Die Sinne von Walden“, seinem jetzt erstmals auf Deutsch erscheinenden Hauptwerk fragt der amerikanische Philosoph Stanley Cavell anhand von „Walden“, was einen Text zu einem initialen, einem originalen Text und weiterführend, was Philosophie zu Philosophie macht. In einem Nachwort stellt Mark Greif den bei uns wohl eher als Mythos bekannten Cavell als Lehrer einer ganzen Generation von Intellektuellen vor. Ebenfalls bei Matthes & Seitz erschienen und von Esther Kinsky herausgegeben sind Thoreaus Betrachtungen vor der Haustür: „Lob der Wildnis“, ein Gang durch die Jahreszeiten in neuer Übersetzung. „Der Wert dieser wilden Früchte liegt nicht in ihrem Besitz oder Verzehr, sondern in ihrem Anblick und der Freude, die man an ihnen hat.“
Der auch Ghandi und Martin Luther King beflügelnde Prophet des Widerstands, dem eine einzige Nacht im Gefängnis genügte, um daraus „Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat“ zu entwickeln, sei noch mit einem weiteren Satz zitiert:
„Wenn ein Mann die Hälfte eines Tages in den Wäldern aus Liebe zu ihnen umhergeht, so ist er in Gefahr, als Bummler angesehen zu werden; aber wenn er seinen ganzen Tag als Spekulant ausnützt, jene Wälder abschert und die Erde vor der Zeit kahl macht, so wird er als fleißiger und unternehmender Bürger geschätzt.“
Alf Mayer
Henry David Thoreau: Kap Cod. Aus dem Amerikanischen übersetzt und herausgegeben von Klaus Bonn. Mit einem Essay von Ilja Trojanow. Residenz Verlag, St. Pölten/ Salzburg/ Wien 2014. 320 Seiten. 24,90 Euro.
Stanley Cavell: Die Sinne von Walden. Mit einem Vorwort von Mark Greif, übersetzt von Kevin Vennemann. Matthes & Seitz, Berlin 2014. 204 Seiten. 24,90 Euro.
Henry David Thoreau: Lob der Wildnis. Herausgegeben und aus dem amerikanischen Englisch von Esther Kinsky. Mit Zeichnungen von Bettina Krieg, Matthes & Seitz, Berlin 2014. 101 Seiten. 14,90 Euro.
Sharon Purvis Talleys: Thoreau’s Journey to Cape Cod: A Psychohistorical Perspective. Zum PDF.
Eine von Thoreau gezeichnete Landkarte von Kap Cod finden Sie hier.











