 Shakespeare und der Killerblick
Shakespeare und der Killerblick
– Unter den Neuerscheinungen zum 450. Geburtstag Shakespeares ist der Band des Science Fiction-Großmeisters Issac Asimov bemerkenswert – ein Kompendium der besonderen Art. Von Peter Münder
Präludium: An den großartigen, vor kurzem verstorbenen Schauspieler Gert Voss, der nicht nur im Thomas-Bernhard-Land („Ritter, Dene, Voss“) zu Hause war, sondern sich auch mit beängstigender Intensität in seine Shakespeare-Rollen hineinsteigerte, möchte ich hier anlässlich der Shakespeare-Diskussionen zum 450. Geburtstag des Dramatikers aus Stratford (1564–1616) und etlicher Neuerscheinungen noch einmal erinnern.
In seiner fabelhaften, amüsanten und bewegenden Autobiographie „Ich bin kein Papagei“ (zur LitMag-Rezension) erinnert Gert Voss sich an die erbitterten Fehden und Diskussionen mit Claus Peymann während der Proben von „Richard III.“ am Wiener Burgtheater. Es war die Phase, in der die Wiener Anti-Peymann-Kampftruppe den Piefkes aus „Bottropp“ zeigen wollte, dass sie an der blauen Donau nichts verloren hatten, Peymann sowie seine Theatertruppe verhöhnten, schikanierten und ihnen sogar Exkremente in hübsch verpackten Kartons ins Haus schickten.
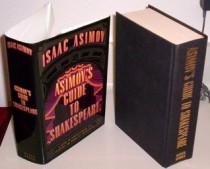 Und „Richard III.“ sollte nun die Nagelprobe sein, die endlich für den erfolgreichen Durchbruch sorgte. Dann aber – „zur Freude unserer Feinde“, wie Voss schreibt – diese „ganz großen Kräche“ mit Peymann: „Abgründe tun sich auf! Ich sehe in deinen Augen den Killer!“, brüllte Peymann mich an, und ich brüllte zurück …“ Voss hatte den Killerblick entwickelt, als er sich während der Proben in die Figur des machtbesessenen Krüppels hineingesteigert hatte, die alle Gegner vernichten will und sich selbst dann angesichts einer ach so schlechten Welt bemitleidet wie ein Kind. Seine Erläuterungen zu dieser komplexbeladenen, von Vernichtungs-Phantasien besessenen Figur, die für die Gesellschaft „die Drecksarbeit“ leistet, zeigen, mit welcher Inbrunst und welch großem Verständnis er Shakespeare und besonders diese Extremrolle durchdrungen hatte. Mit seinem gigantischen Richard-Erfolg hatte Gert Voss („Wir werden seinesgleichen nimmer sehen“, erklärte Gerhard Stadelmaier im FAZ-Nachruf) dann tatsächlich den Durchbruch für Peymann und die Truppe aus Bottrop geschafft.
Und „Richard III.“ sollte nun die Nagelprobe sein, die endlich für den erfolgreichen Durchbruch sorgte. Dann aber – „zur Freude unserer Feinde“, wie Voss schreibt – diese „ganz großen Kräche“ mit Peymann: „Abgründe tun sich auf! Ich sehe in deinen Augen den Killer!“, brüllte Peymann mich an, und ich brüllte zurück …“ Voss hatte den Killerblick entwickelt, als er sich während der Proben in die Figur des machtbesessenen Krüppels hineingesteigert hatte, die alle Gegner vernichten will und sich selbst dann angesichts einer ach so schlechten Welt bemitleidet wie ein Kind. Seine Erläuterungen zu dieser komplexbeladenen, von Vernichtungs-Phantasien besessenen Figur, die für die Gesellschaft „die Drecksarbeit“ leistet, zeigen, mit welcher Inbrunst und welch großem Verständnis er Shakespeare und besonders diese Extremrolle durchdrungen hatte. Mit seinem gigantischen Richard-Erfolg hatte Gert Voss („Wir werden seinesgleichen nimmer sehen“, erklärte Gerhard Stadelmaier im FAZ-Nachruf) dann tatsächlich den Durchbruch für Peymann und die Truppe aus Bottrop geschafft.

Gert Voss (Pressefoto/Quelle)
So brillant und einfühlsam über Shakespeare und dessen Figuren zu reflektieren und zu schreiben, ist jedoch eine Kunst, die nur wenige beherrschen. Als der polnische Theatermann Jan Kott sich in seinem Band 1961 über „Shakespeare Heute“ Gedanken machte, da lag ihm der Vergleich mit Becketts Untergangsvisionen am Herzen, weil ihm die düsteren Krisenzeiten nach Hiroshima und mitten im Kalten Krieg ähnlich beängstigend erschienen wie den Elisabethanern zur Zeit Shakespeares. Das entwickelte Kott sehr anschaulich und überzeugend. Wenn jetzt aber an den Londoner Trafalgar Studios in der Regie von Jamie Lloyd eine modernistische „Richard III.“-Inszenierung mit Martin Freeman als Putschisten in der Hauptrolle suggerieren soll, unter dem harmlos-modischen Outlook eines machtbewssten Machiavellisten würden die psychopathischen Züge dieses Tricky Dick erst durch die besonderen Umstände der Zeitläufe herausgekitzelt, dann ist das doch zu simpel und verharmlosend gestrickt.
Ganz abgesehen von der irritierenden Verlagerung der Rosenkriege in die britischen 70er Jahre, als man an der Themse eine Diktatur erträgt, die mit einem Putsch beseitigt werden soll – was dann in dieser Jamie-Lloyd-Version einen ziemlich sinnlosen Plot ergibt. Und die billigen, sich anbiedernden Spaßeinlagen, die der Hobbit- und Sherlock-Holmes-Star Freeman für die begeisterten Groupies im Publikum präsentiert, scheinen direkt von einem GZSZ-Remake abgekupfert zu sein. Aber keine Frage: Richard III. als machtbesessener, blutrünstiger Diktator, Shakespeare als Zeitgenosse- das ist immer wieder ein aktuelles Thema.
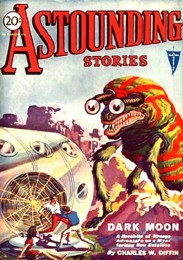 Inzwischen gibt es längst so wunderbare historisch-biographische Allround-Studien wie die von Peter Ackroyd (Shakespeare – The Biography), Stephen Greenblatts „Will in the World“, außerdem das überragende, in Shakespeares Alltag als Schreiber und Theatermann eintauchende Meisterwerk „1599“ von James Shapiro sowie sein grandioser kritischer „Enthüllungskrimi“ über die aberwitzigen Theorien zum vermeintlich „echten“ Shakespeare „Contested Will – Who wrote Shakespeare?“, in dem er die Thesen all der oberschlauen Skeptiker ad absurdum führte, die dem Dorflümmel aus Stratford nicht zutrauten, seine Stücke und Sonette selbst geschrieben zu haben und sich ihre eigenen „Top-Autoren“ wie Christopher Marlowe, Francis Bacon, den Earl of Oxford u.a. als Favoriten mit abenteuerlichen Begründungen fabriziert hatten. (Vgl. hierzu LitMag: „Shakespeare und sein Ghostwriter“)
Inzwischen gibt es längst so wunderbare historisch-biographische Allround-Studien wie die von Peter Ackroyd (Shakespeare – The Biography), Stephen Greenblatts „Will in the World“, außerdem das überragende, in Shakespeares Alltag als Schreiber und Theatermann eintauchende Meisterwerk „1599“ von James Shapiro sowie sein grandioser kritischer „Enthüllungskrimi“ über die aberwitzigen Theorien zum vermeintlich „echten“ Shakespeare „Contested Will – Who wrote Shakespeare?“, in dem er die Thesen all der oberschlauen Skeptiker ad absurdum führte, die dem Dorflümmel aus Stratford nicht zutrauten, seine Stücke und Sonette selbst geschrieben zu haben und sich ihre eigenen „Top-Autoren“ wie Christopher Marlowe, Francis Bacon, den Earl of Oxford u.a. als Favoriten mit abenteuerlichen Begründungen fabriziert hatten. (Vgl. hierzu LitMag: „Shakespeare und sein Ghostwriter“)
Nun aber zur eigentlichen Neuerscheinung. Asimovs Shakespeare-Kompendium stellt eine optimale Ergänzung der malerischen, mit bunten biographischen Details aufgepeppten und verdichteten Bände von Shapiro, Ackroyd und Greenblatt dar. Der Band ist die gekürzte deutsche Übersetzung seines bereits 1970 veröffentlichten zweibändigen „Guide to Shakespeare“. Mancher wird sich verwundert die Augen reiben: War der Vielschreiber Asimov (1920–1992), der über 400 Bücher verfasste, nicht Science-Fiction-Autor? Ja schon – aber er interessierte sich eben auch für griechisch-römische Geschichte, für Biochemie und diverse andere Naturwissenschaften und für die Elisabethaner.
 Asimov wuchs als Sohn eines Candyshop-Betreibers in Brooklyn auf, war Prof für Biochemie in Boston und kam schon als Junge zum Schreiben, weil er von den „Astounding Stories“-Groschenheften, die sein Vater im Laden verhökerte, absolut fasziniert war und selbst so ähnliche tollkühne Science-Fiction-Storys fabrizieren wollte, wie Tobias Döring, Präsident der Deutschen Shakespeare Gesellschaft, in seinem Vorwort erklärt. Döring sieht Asimovs Band als eine Art Führer durch die Shakespeare-Galaxie. Das ist ja nicht abwegig – nur wird damit auch angedeutet, diese Galaxie stelle vielleicht eine Art zusammenhängendes System oder Weltbild dar – was ein Irrtum wäre und eine Wiederbelebung all der Diskussionen übereifriger Schubladen-Pedanten und Systemtheoretiker zur Goethe-Zeit. Die konnten sich ja ein Ordnungssystem ohne klare Kategorien, moralische Leitideen und Anweisungen für das Publikum nicht vorstellen. Goethe selbst tendierte ursprünglich ja auch dazu, erschreckt durch die englische Theatre-in-the-Round-Bühne ohne die rigiden Sehgewohnheiten der Guckkasten-Bühne , sich nach altvertrauten Vorgaben und perspektivischen Leitplanken des guten alten Guckkastens zu sehnen. Dann erkannte er jedoch die Vorteile der runden offenen englischen Bühne, zog die kritische Reißleine und wurde (Vgl. „Shakespeare und kein Ende“) zum großen Fan des Barden aus Stratford: „Er führt uns durch die ganze Welt, aber wir verzärtelte unerfahrne Menschen schrein bey ieder fremden Heuschrecke, die uns begegnet: Herr, er will uns fressen!“
Asimov wuchs als Sohn eines Candyshop-Betreibers in Brooklyn auf, war Prof für Biochemie in Boston und kam schon als Junge zum Schreiben, weil er von den „Astounding Stories“-Groschenheften, die sein Vater im Laden verhökerte, absolut fasziniert war und selbst so ähnliche tollkühne Science-Fiction-Storys fabrizieren wollte, wie Tobias Döring, Präsident der Deutschen Shakespeare Gesellschaft, in seinem Vorwort erklärt. Döring sieht Asimovs Band als eine Art Führer durch die Shakespeare-Galaxie. Das ist ja nicht abwegig – nur wird damit auch angedeutet, diese Galaxie stelle vielleicht eine Art zusammenhängendes System oder Weltbild dar – was ein Irrtum wäre und eine Wiederbelebung all der Diskussionen übereifriger Schubladen-Pedanten und Systemtheoretiker zur Goethe-Zeit. Die konnten sich ja ein Ordnungssystem ohne klare Kategorien, moralische Leitideen und Anweisungen für das Publikum nicht vorstellen. Goethe selbst tendierte ursprünglich ja auch dazu, erschreckt durch die englische Theatre-in-the-Round-Bühne ohne die rigiden Sehgewohnheiten der Guckkasten-Bühne , sich nach altvertrauten Vorgaben und perspektivischen Leitplanken des guten alten Guckkastens zu sehnen. Dann erkannte er jedoch die Vorteile der runden offenen englischen Bühne, zog die kritische Reißleine und wurde (Vgl. „Shakespeare und kein Ende“) zum großen Fan des Barden aus Stratford: „Er führt uns durch die ganze Welt, aber wir verzärtelte unerfahrne Menschen schrein bey ieder fremden Heuschrecke, die uns begegnet: Herr, er will uns fressen!“
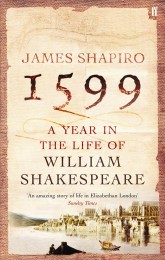 Asimovs Buch ist eine ideale Ergänzung in diesem bunten Strauß der Shakespeare-Studien, weil es sich eher als enzyklopädisches Kompendium versteht, das historische Hintergrund-Fakten zu den Stücken liefert. Wer also wissen will, wer alles in die York v. Lancaster-Rosenkriege verwickelt war, die ja den Hintergrund von Richard III. bilden, wie Shakespeare überhaupt auf den dänischen Prinzen Hamlet kam, warum Umstandskrämer Hamlet sich mit pedantischer Sorgfalt seine simulierten Wahnsinns-Manöver und Tricks einfallen lässt, welche Quellen und Bezüge es für den „Sturm“ oder „Othello“ gab, der wird bei Asimov fündig. Er schreibt in einem klaren, gut lesbaren Stil, streut viele Zitate ein, die den Gang der Handlung beleuchten und verliert nie die entscheidenden Aspekte aus dem Blick. Völlig ausgeblendet werden Aufführungsgeschichte und Rezeptionsgeschichte der Dramen, was mitunter zur eher trockenen Exegese der hier besprochenen zwölf an deutschen Bühnen meistaufgeführten Shakespeare-Dramen führt. Die zwölf von Asimov behandelten Stücke sind: Mittsommernachtstraum, Romeo und Julia, Der Kaufmann von Venedig, Viel Lärm um Nichts, Wie es euch gefällt, Was ihr wollt, Othello, Der Sturm, König Lear, Hamlet, MacBeth und Richard III.
Asimovs Buch ist eine ideale Ergänzung in diesem bunten Strauß der Shakespeare-Studien, weil es sich eher als enzyklopädisches Kompendium versteht, das historische Hintergrund-Fakten zu den Stücken liefert. Wer also wissen will, wer alles in die York v. Lancaster-Rosenkriege verwickelt war, die ja den Hintergrund von Richard III. bilden, wie Shakespeare überhaupt auf den dänischen Prinzen Hamlet kam, warum Umstandskrämer Hamlet sich mit pedantischer Sorgfalt seine simulierten Wahnsinns-Manöver und Tricks einfallen lässt, welche Quellen und Bezüge es für den „Sturm“ oder „Othello“ gab, der wird bei Asimov fündig. Er schreibt in einem klaren, gut lesbaren Stil, streut viele Zitate ein, die den Gang der Handlung beleuchten und verliert nie die entscheidenden Aspekte aus dem Blick. Völlig ausgeblendet werden Aufführungsgeschichte und Rezeptionsgeschichte der Dramen, was mitunter zur eher trockenen Exegese der hier besprochenen zwölf an deutschen Bühnen meistaufgeführten Shakespeare-Dramen führt. Die zwölf von Asimov behandelten Stücke sind: Mittsommernachtstraum, Romeo und Julia, Der Kaufmann von Venedig, Viel Lärm um Nichts, Wie es euch gefällt, Was ihr wollt, Othello, Der Sturm, König Lear, Hamlet, MacBeth und Richard III.
Über Asimovs eigenartige Klassifikation von ursprünglich vier Kategorien der amerikanischen zweibändigen Ausgabe – nämlich der griechischen, römischen, italienischen und englischen Stücke- kann man natürlich streiten: Was spricht denn gegen die traditionelle Einteilung in Komödien, Tragödien und Historien oder gegen eine chronologische Reihenfolge?
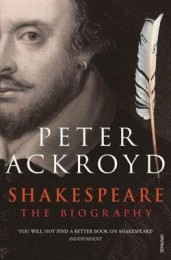 Asimov hatte sich als SF-Autor ja auch auf den Aufstieg und Fall galaktischer Imperien kapriziert, vielleicht war dieser Aspekt der Unfähigkeit oder Überlebensfähigkeit von Dynastien der Auslöser für sein Shakespeare-Interesse. Hier kommentiert er jedenfalls die Rosenkriege (Richard III.), Hamlets Überwachungsphobie und Tarnmanöver gegenüber dem mißtrauischen Claudius oder die Macbeth- Mordpläne sehr souverän und einleuchtend. Er sieht Shakespeare eben nicht als hehren Schulmeister oder als Jung-Hegelianer, der uns als Luftschiffer des Geistes eine allumfassende Philosophie eintrichtern will. Sondern als Debatten-Anreger, dem die runde Globe-Bühne als herrlich offenes und flexibles Medium die optimale Möglichkeit für Entertainment und kritische Diskussionen bot. Aktuelle Bezüge und Aspekte zur NSA-Debatte und zu staatlichen Überwachungssystemen, zum Antisemitismus, zu Putschversuchen gegen autoritäre Herrscher usw. kann jeder Leser ja selbst – je nach hermeneutischem Tunnelblick- aus den Texten herauslesen.
Asimov hatte sich als SF-Autor ja auch auf den Aufstieg und Fall galaktischer Imperien kapriziert, vielleicht war dieser Aspekt der Unfähigkeit oder Überlebensfähigkeit von Dynastien der Auslöser für sein Shakespeare-Interesse. Hier kommentiert er jedenfalls die Rosenkriege (Richard III.), Hamlets Überwachungsphobie und Tarnmanöver gegenüber dem mißtrauischen Claudius oder die Macbeth- Mordpläne sehr souverän und einleuchtend. Er sieht Shakespeare eben nicht als hehren Schulmeister oder als Jung-Hegelianer, der uns als Luftschiffer des Geistes eine allumfassende Philosophie eintrichtern will. Sondern als Debatten-Anreger, dem die runde Globe-Bühne als herrlich offenes und flexibles Medium die optimale Möglichkeit für Entertainment und kritische Diskussionen bot. Aktuelle Bezüge und Aspekte zur NSA-Debatte und zu staatlichen Überwachungssystemen, zum Antisemitismus, zu Putschversuchen gegen autoritäre Herrscher usw. kann jeder Leser ja selbst – je nach hermeneutischem Tunnelblick- aus den Texten herauslesen.
Asimov ist kein Thesenritter; er überzeugt mit seiner ruhigen, am historischen Kontext orientierten Beschreibung und Interpretation. Die Verteidigungsrede des raffgierigen, „typisch jüdischen“ Schuldeneintreibers Shylock, der auf dem Pfund Fleisch als Zins-Zahlung beharrt, kommentiert er so: „Shylock behauptet nicht, daß er besser sei als ein Christ. Er behauptet lediglich, nicht schlechter zu sein … Ohne auch nur die Spur eines schlechten Gewissens wird er von allen im Stück gedemütigt und schikaniert, an keiner Stelle wird dieses Verhalten jemals als falsch dargestellt. Nicht einmal Antonio, der ja geradezu einen Heiligen verkörpert, sieht darin ein Unrecht. Shylock zumindest erkennt Boshaftigkeit, wenn er sie vor sich hat. Seinen eigenen Plan stellt er unverhohlen als boshaft dar. Er rechtfertigt sich damit, daß er nur von Christen gelernt habe. Indem er die Boshaftigkeit beim Namen nennt, stellt er auch die Moral seiner Peiniger in Frage“.
Oft flackern Asimovs geradezu galaktische, kritisch-distanzierte Einschätzungen und seine Einsichten in historische Prozesse in seinen knappen Anmerkungen und Apercus auf. So hält er etwa das auf ein versöhnliches Ende im bluttriefenden Richard III.-Gemetzel angelegte Schlußbild für ziemlich fragwürdig, weil die historische Figur Heinrich VII. in kitschig-verklärender Manier konterkariert werde: „Vor allem die Friedenssehnsucht der Engländer war der eigentliche Grund dafür, daß sich Heinrich VII. so lange auf dem Thron halten konnte. In Wirklichkeit war er nämlich ein eiskalter, harter, habgieriger Mensch, also das genaue Gegenteil des Tugendboldes, zu dem ihn Shakespeare stilisiert.“
 Der phantasievolle, manchmal allzu erfinderische Shakespeare-Übersetzer Hans Rothe hatte sich schon vor fünfzig Jahren über die philosophischen Systemsucher mokiert, die bei Shakespeare unbedingt das große zusammenhängende Gedankengebäude entdecken wollten und dazu bemerkt: „Die Grundidee, säuberlich erarbeitet und geistesgeschichtlich verankert, ist das einzige, was man bei Shakespeare nicht suchen darf. Danach befragt, würde er durch jedes deutsche Examen fallen. Dafür hat er auf jedem deutschen Theater triumphiert, wo diese Frage nicht gestellt wurde“.
Der phantasievolle, manchmal allzu erfinderische Shakespeare-Übersetzer Hans Rothe hatte sich schon vor fünfzig Jahren über die philosophischen Systemsucher mokiert, die bei Shakespeare unbedingt das große zusammenhängende Gedankengebäude entdecken wollten und dazu bemerkt: „Die Grundidee, säuberlich erarbeitet und geistesgeschichtlich verankert, ist das einzige, was man bei Shakespeare nicht suchen darf. Danach befragt, würde er durch jedes deutsche Examen fallen. Dafür hat er auf jedem deutschen Theater triumphiert, wo diese Frage nicht gestellt wurde“.
Asimov hat sich offenbar – ähnlich wie weiland Shakespeare – in der Tradition der anti-autoritären Aufklärer gesehen. Jedenfalls eröffnet er uns in diesem beeindruckenden Kompendium mit seinem unaufgeregten Stil und einem profunden historischen Detailwissen häufig neue Perspektiven und Zusammenhänge, die den Barden aus Stratford immer noch als aktuellen, kritischen Debattenanreger erkennbar werden lassen.
Peter Münder
Isaac Asimov: Shakespeares Welt. Was man wissen muß, um Shakespeare zu verstehen. Vorwort von Tobias Döring, übersetzt von Anemone Bauer, Birke Bossmann u.a. (Sammelübersetzung) Alexander Verlag Berlin 2014. Verlagsinformationen zum Buch.
Peter Ackroyd: Shakespeare. The Biography. Chatto & Windus London 2005
Stephen Greenblatt: Will in the World. How Shakespeare became Shakespeare. Norton Publ. New York/London 2004
James Shapiro: 1599 – A Year in the life of Shakespeare. Faber & Faber 2005
Ders.: Contested Will – Who wrote Shakespeare? Faber & Faber 2010
Jan Kott: Shakespeare Heute. Aus dem Polnischen von Peter Lachmann. Albert Langen Verlag, München 1964











