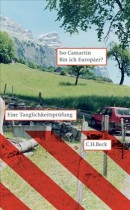 Europa als Heimat?
Europa als Heimat?
Von einem so leicht daherkommenden Autor lässt man sich gerne zu einem Nachdenken über Europa als Hoffnungsprojekt verführen. Jedenfalls hat das Europa des Iso Camartin mehr Charme und Reiz als die täglich mehr werdenden EU-Richtlinien für die Paketzustellung innerhalb von Europa.
Seine nicht genug zu lobenden „Sechs Vorschläge für das nächste Jahrtausend“ beginnt Italo Calvino mit einem Kapitel über die ‚Leichtigkeit’. Sie sei ein Wert und kein Mangel. Die Literatur habe die existenzielle Aufgabe, Leichtigkeit zu suchen „als Reaktion auf die Schwere des Lebens“. Und Paul Valèry hat einmal gesagt: Es gilt, leicht zu sein wie ein Vogel, nicht wie eine Feder“. Ein in diesem Sinne ‚leichter Vogel’ unter den zeitgenössischen Essayisten deutscher Sprache ist sicherlich der schweizer Iso Camartin. Welchem Thema, welchem Kunstwerk, welcher Landschaft er sich in seinen Texten auch widmet, stets vernimmt man einen leichten Ton in seiner Argumentation, der nichts mit Seichtheit, Oberflächlichkeit, Flüchtigkeit zu tun hat.
Im Gegenteil: Camartin ist sehr belesen, kennt sich in der Welt der Oper genauso gut aus wie in der Malerei. Bewegt sich leicht zwischen verschiedenen Sprachen hin und her. Er weiß viel, aber nichts wäre unpassender, ihn als einen ‚Besserwisser’ zu titulieren. Einen Lehrer könnte man ihn nennen, aber einen der keine Noten vergibt, sondern der sein kulturelles Wissen andere gerne in leichter Form vermittelt.
Nach „Belvedere“, einem klugen und nie naiv populär daherkommenden Plädoyer für das Medium Fernsehen, ist sein neues Buch „Europa“ gewidmet. Aber von den europäischen Institutionen und von der Rolle Europas in der Welt erfährt man hier nichts. Vielmehr versucht Camartin aus immer neuen Perspektiven zu umkreisen, was man vielleicht unter einem ‚europäischen Bewußtsein’ oder einer ‚europäischen Kultur’ verstehen könnte und für die es sich zu streiten lohnt.
„Europäisches Bewusstsein lebt von einer hohen Toleranz für Komplexität und Vielfalt… Europäisch denken bedeutet, es als eine Selbstverständlichkeit anzusehen, dass Minderheiten und Randkulturen das Erscheinungsbild europäischer Wirklichkeit prägen“.
Diese große Achtung von Vielfalt und Minderheitenkulturen hat bei Iso Camartin auch ein biographisches Fundament. Als gebürtiger Graubündner musste er auch in der mehrsprachigen Schweiz immer für ein uneingeschränktes Existenzrecht des Räteromanischen neben der deutschen, französischen und italienischen Sprache kämpfen. Aber sein Plädoyer für die Minderheitensprachen und die Randkulturen nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Europa, kommt niemals tümelnd, niemals in einem dumpf-konservativen Sinne ‚provinziell’ daher. Aus der Erinnerung an schöne Fleckenteppiche in alten Bauernhäuser entwickelt er zum Bespiel seine Idee von einem mehrsprachigen, von vielen Kulturen durchwobenen Europa:
„Alles, was die Familie einmal an Kleidern getragen und an Textilien verwendet hat und was sich einer direkten Wiederverwertung wegen Abnützung entzog, endete in einem solchen Fleckenteppich… Der Sprachenteppich, auf dem wir einherwandeln, ist eines der entscheidenden Merkmale unserer Weltorientierung und unserer gesellschaftlichen Zugehörigkeit.“
Konfrontiert mit dem täglichen Gegeneinander verschiedener Kulturen im europäischen Alltag oder der Vereinheitlichung unserer Kommunikation auf ein reduziertes, nur funktionales Englisch, erscheinen einem die europäischen Idealbilder von Iso Camartin gelegentlich etwas ‚weltfremd’ und vielleicht zu optimistisch. Aber wie anders als durch das vogelleichte Skizzieren von Möglichkeiten und Idealen kommen wir denn auch heraus aus unserem ansonsten üblichen trägen Europapessimismus?
Für dieses weltoffene, neugierige, sprachgewandte Europa bedarf es auch Vorbilder jenseits der an den Feiertagen immer genannten ‚europäischen Gründungsväter’ wie Adenauer, Schuman oder de Gasperi. Für Iso Camartin ist der schweizer Kulturkritiker und Publizist Francois Bondy ein exemplarischer Europäer, von dem zu lernen ist. 1915 in Berlin geboren, in Österreich aufgewachsen, in Paris ausgebildet, in der Schweiz lebend und dort auch im Jahr 2005 gestorben, stand Bondy Jahrzehnte lang in einem Kontakt zu Intellektuellen in aller Welt.
„Unter all denen, die versuchten, dem Isolationismus, Partikularismus und der Selbstgenügsamkeit nationaler Traditionen entgegenzuschreiben, war Bondy eine Gestalt von unvergleichlichem Rang.“
Nicht bei jedem der hier versammelten Beiträge ist ein Bezug zum Dachthema „Europa“ unmittelbar einleuchtend, etwa bei der Erinnerung an die Heilige Cäcilia, der Patronin der Musik oder einem Plädoyer für die Langsamkeit. Auch fehlen völlig Gedanken zu den sozialen Konflikten oder den wuchernden Feindschaften zwischen den jeweiligen kulturellen Traditionen. Trotzdem lässt man sich von einem so leicht daherkommenden Autor gerne zu einem Nachdenken über Europa als Hoffnungsprojekt verführen. Jedenfalls hat das Europa des Iso Camartin mehr Charme und Reiz als die täglich mehr werdenden EU-Richtlinien für die Paketzustellung innerhalb von Europa.
Carl Wilhelm Macke
Iso Camartin: Bin ich ein Europäer. Eine Tauglichkeitsprüfung. Beck-Verlag, Muenchen, 2006, 128 S.











