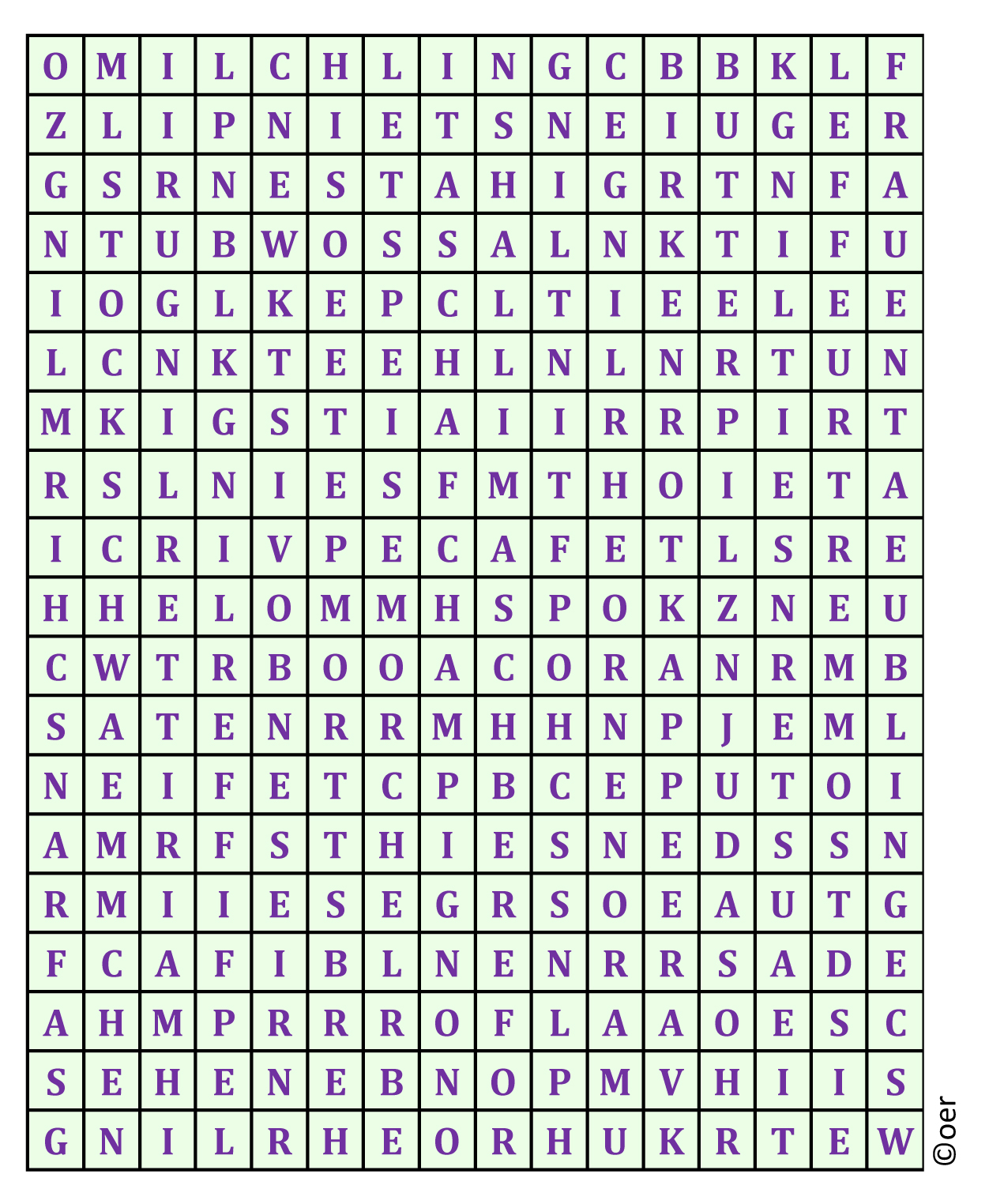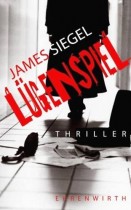 Last Exit Littleton
Last Exit Littleton
Wer einmal lügt, dem traut man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. James Siegel nimmt sich das Sprichwort zu Herzen und strickt daraus die Tragödie eines Starreporters. Wenig einleuchtend für Jörg von Bilavsky
Journalisten haben die Wahrheit nicht gepachtet. Aber bei der Wahrheit sollten sie schon bleiben. Verstoßen sie einmal oder mehrfach gegen den Pressekodex, dann werden sie selbst verstoßen. Starreporter Tom Valle hat sechsundfünfzig Mal mit der goldenen Regel des Journalismus gebrochen, bevor ihm Redaktion, Richter und Psychotherapeuten seine Lügengeschichten von bombenlegenden Kinderärzten oder vom Heldentod eines Nationalgardisten um die Ohren gehauen haben. Statt des ruhmreichen Pulitzerpreises ergattert er nur noch den Redakteursposten in einem kalifornischen Kaff. Littleton scheint von nun an die Endstation seines Lebens zu sein. So will es Bestsellerautor James Siegel, der den Lügenbold die Wahrheit über die ungeheuerliche Vergangenheit dieses Ortes und seiner einstigen Einwohner recherchieren lässt. Aber wer kauft einem Borderlinejournalisten schon eine wahre Geschichte ab? Niemand.
Dicke Tünche
Es ist eine dramaturgisch verführerische Idee, den Bock zum Gärtner zu machen und ihn sich die Hörner abstoßen zu lassen. Man leidet mit dem moralischen Missetäter sogar mit, wenn er Polizei und Chefredakteur davon zu überzeugen sucht, dass er kurz davor ist, einen Skandal staatstragenden Ausmaßes aufzudecken. Allerdings geht es dabei doch arg mit dem Zufall zu. Dass Valle als Reporter zu einem Autounfall gerufen wird und dabei eine Leiche mit falschen Namen entdeckt ist das eine. Dass er bei dem Bericht über eine Hundertjährige auf Glückwünsche eines angeblich verschollenen Kindes stößt das andere. Dass diese beiden Entdeckungen mit einem verheerenden Staudammbruch aus dem Jahre 1954 zusammenhängen könnten, ist noch unglaublicher. Dazu bedarf es schon der Phantasie eines Enthüllungsjournalisten für den Fiktion und Realität zwei Seiten einer Medaille sind. Kein Wunder, dass man Valle und seinem ebenso fantasiebegabten Schöpfer das noch abenteuerlicher werdende Konstrukt nicht immer abnimmt.
Nicht nur, weil sich ganz Littleton gegen Valle verschworen zu haben scheint. Sondern auch, weil Siegel moralisch und literarisch sehr dick aufträgt. Freilich möchte man nicht in der Haut eines Lügners stecken, der wegen seiner Vergehen gegen die journalistische Redlichkeit von allen angefeindet wird und als Kind unter einer versoffenen und gewalttätigen Mutter zu leiden hatte. Aber dieser Mischung aus Selbstmitleid und Trotz wird man irgendwann überdrüssig. Weil Siegel Opfer seiner literarischen Ambitionen wird und über der kunstvollen Formulierung innerer Monologe und Fieberträume vergisst, die scheinbar zusammenhangslosen Fäden der Geschichte in einem festen Erzählstrang zu bündeln. Weshalb Valle respektive Siegel seine Leser zum Schluss nicht ohne Grund fragt: „Konnten Sie mir bis hierher folgen? Habe ich alles ausreichend verdeutlicht? Erhellt? Klargemacht? Oder muss ich dieses Gesums noch einmal wiederkäuen?“
Besser nicht! Lieber sollte Siegel sich wieder auf seine Qualitäten als Autor spannungsgeladener Thriller besinnen. Statt sich als postmoderner Literat zu versuchen, der seinen Protagonisten andeutungsschwanger über die „Konventionen eines billigen Thrillers“ räsonieren lässt und dafür selbst die Kunst des Krimischreibens aus den Augen verliert.
Jörg von Bilavsky
James Siegel: Lügenspiel (Deceit, 2006) Roman. Deutsch von Axel Merz. München: Ehrenwirth 2008. 427 Seiten. 19,95 Euro.