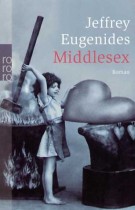 Im Olymp angekommen
Im Olymp angekommen
Wovon der Held in seinem Roman – zu einer Zeit, als er noch eine Heldin ist – träumt, hat der Autor Eugenides bereits erreicht: ein wahrhaft phänomenales Buch. Geschrieben mit einer einzigartigen Dreifaltigkeit aus Hirn, Herz und Humor.
Als routinierter Leser glaubt man allzu leicht, den Überblick über den Buchmarkt behalten zu können und Autoren, die einen beeindruckt haben, nicht aus den Augen zu verlieren. Doch wenn sich ein Schriftsteller allzu viel Zeit mit seinem zweiten Buch lässt, kann es durchaus passieren, dass man ihn schon nicht mehr auf der persönlichen Bestenliste führt – und dann kann ein Wieder-Entdecken zu einem wahren Neu-Entdecken führen.
Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass im schon lange wieder vom Markt verschwundenen Byblos-Verlag der Roman „Die Selbstmord-Schwestern“ des damals unbekannten Jeffrey Eugenides erschien. Der glänzend erzählte Roman, in dem wie in einem Puzzle die Geschichte der aufeinander folgenden Selbstmorde von vier Schwestern erzählt wird, hat mich schier begeistert und sehnsüchtig auf weitere Werke aus Eugenides’ Feder warten lassen. Doch diese folgten nicht. Eine erfolgreiche Verfilmung der „Virgin Suicides“ kam in die Kinos, doch der Name Eugenides verblasste langsam in meiner Erinnerung. Erst im letzten Jahr, in einer Dubliner Buchhandlung, fiel mir plötzlich ein Riesenwälzer in die Hände, auf dem jener Name stand, der schlagartig meine Erinnerung weckte und damit auch die Neugierde auf dieses Buch. Da das Urlaubsbudget für diverse Bücherkäufe allerdings eh schon arg strapaziert war und die Zeit für über 700 Seiten in englischer Sprache doch recht knapp, habe ich sehnsüchtig auf die deutsche Ausgabe gewartet. Auch wenn es heißt, dass Vorfreude die schönste Freude sei – in diesem Fall stimmt das Sprichwort nicht: „Middlesex“ übertrifft die ohnehin hohen Erwartungen, die ich an Eugenides gestellt habe, noch um ein Vielfaches.
„Ich wurde zweimal geboren: zuerst, als kleines Mädchen, an einem bemerkenswert smogfreien Januartag 1960 in Detroit und dann, als halbwüchsiger Junge, in einer Notfallambulanz in der Nähe von Petoskey, Michigan, im August 1974.“ – Wenn dieser Romaneinstieg nicht in die Riege legendärer erster Sätze aufgenommen gehört…
Eugenides erzählt die Geschichte von Cal, der als Calliope auf die Welt kommt, der von einem unaufmerksamen Arzt als Mädchen identifiziert und als solches erzogen wird. Erst mit Beginn der Pubertät soll Calliope merken, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Doch Eugenides erzählt weit mehr als nur die Lebensgeschichte eines Hermaphroditen: Sein Roman umspannt mehrere Generationen einer turbulenten Familiengeschichte, wird zu einer mitreißenden Chronik von Einwandererschicksalen. Gleich mehrere wundervolle Liebesgeschichten hat er in diesen Roman eingewoben, Stoff, aus dem andere Autoren fünf Romane geflochten hätten. Von Querverweisen auf griechische Mythologie und amerikanische Politik ganz zu schweigen. Ich weiß gar nicht, welchen Handlungsstrang ich herausgreifen soll, um die Genialität und strahlende Schönheit dieses Romans zu demonstrieren. Soll ich erzählen von den Geschwistern Desdemona und Lefty, die Anfang der Zwanziger Jahre auf der Flucht vor den Türken Griechenland unter tragischen Umständen verlassen und als Liebespaar auf dem Schiff nach Ellis Island ihre Lebensgeschichte neu erfinden? Oder soll ich erzählen von den Klarinettenständchen, mit denen Milton den Körper seiner Tessie zum Schwingen bringt und ihr Herz für sich gewinnt? Oder soll ich von Calliopes unglücklicher Liebe zu einer Schulfreundin erzählen, als sie bereits unbewusst ihre Andersartigkeit spürt? Oder soll ich in der Berliner Gegenwart ansetzen, in der Cal sich in die Asiatin Julie verliebt und nicht weiß, wie er ihr beichten soll, dass er anders ist als andere Männer? Oder sollte ich eine der zahllosen Nebenfiguren vorstellen? Den unglücklichen armenischen Arzt Dr. Philosobian vielleicht, den verschlagenen Alkoholschmuggler Jimmy Zizmo, Calliopes lesbische Großtante Sourmelina oder ihren Priester-Onkel Father Mike, der für eine weitere schreckliche Wendung in der Geschichte sorgen wird? – Ich weiß es einfach nicht.
Und es sind nicht nur die Schicksale der Familie Stephanides, die den Roman schier aus den Nähten platzen lassen, es ist vor allem Eugenides’ Erzählkunst, die mitreißt, schmunzeln, lachen und weinen macht. Eugenides lässt seinen Erzähler mit dem Leser plaudern, scheinbar die Karten auf den Tisch legen, um dann doch noch erzählerische Trümpfe aus dem Ärmel zu zaubern. Calliope/Cal wird zu einem wahren Begleiter des Lesers, greift in der Zeit vor oder spult die Ereignisse wie einen Film zurück, lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers auf Details und freut sich über dessen staunende Augen. Und wie beinahe jedem guten Erzähler der Literaturgeschichte kann man auch Cal nicht wirklich trauen: Nicht nur, dass er in schillernder Detailtreue Zeiten lange vor seiner Geburt auferstehen lässt und ohne Zögern in die Gedankenwelt seiner Vorfahren eindringt (und nur selten zugibt, dass er bei der Beschreibung dieser Stellen seiner Phantasie freien Lauf lassen muss) – nein, als er davon berichtet, wie er als Untersuchungsobjekt eines Sexualforschers ein Journal schreiben muss, gibt er offen zu: „…an dieser Smith Corona entdeckte ich rasch, dass Die-Wahrheit-Sagen lange nicht so viel Spaß machte wie Sachen erfinden“. Humor und tragische Schicksalsschläge liegen hier so nah beieinander wie in den besten Romanen John Irvings, T.C. Boyles oder Philipp Roths; auch die Aura des magischen Realismus lateinamerikanischer Prägung ist zu spüren.
„Schon damals setzten die Great Books mir zu, drängten mich stumm, den vergeblichsten aller Menschheitsträume zu verfolgen – den Traum, ein Buch zu schreiben, das würdig war, in ihre reihen aufgenommen zu werden, ein hundertsechzehntes Great Book mit einem weiteren langen griechischen Neman auf dem Umschlag: Stephanides.“ – Wovon der Held in seinem Roman – zu einer Zeit, als er noch eine Heldin ist – träumt, hat der Autor Eugenides bereits erreicht: ein wahrhaft phänomenales Buch. Geschrieben mit einer einzigartigen Dreifaltigkeit aus Hirn, Herz und Humor. Nun soll er mich bitte nicht wieder zehn Jahre auf sein nächstes Buch warten lassen.
Frank Schorneck
Jeffrey Eugenides: Middlesex. Deutsch von Eike Schönfeld. Rowohlt TB 2004. Kartoniert. 733 Seiten. 9,00 Euro.
ISBN: 3-499-23810-1











