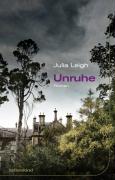 Wie ein abgründiger Traum
Wie ein abgründiger Traum
1999 erschien der Debütroman der heute 39-jährigen australischen Autorin Julia Leigh. In Der Jäger schildert sie, wie die Suche eines Mannes nach einem seltenen Tiger zur Obsession gerät. Der Roman und seine Autorin wurden von der Kritik gefeiert, und Julia Leigh ist inzwischen im englischsprachigen Raum wie auch in Frankreich eine bekannte Autorin. Hierzulande ist sie eher noch ein Tipp – einer, dem man nachgehen sollte, findet Carola Ebeling.
Mit ihrem zweiten, kürzlich auf Deutsch erschienenen Roman Unruhe bietet sich dazu eine gute Gelegenheit. Unheimlich und surreal wirkt gleich die erste Szenerie: Eine Frau und ihre zwei Kinder vor einem großen Tor in einer trostlosen Landschaft. Gestrandet wirkt die kleine Gruppe, Einlass gewährt man – wer nur? – ihnen nicht durch dieses Tor. Schließlich zwängen sie sich mit Gewalt durch eine Holztür, eingelassen in eine endlose Mauer, die ein riesiges Grundstück umgibt. Darauf eine Art Schlösschen, das offenbar das Ziel der Frau ist.
Die Frau stieg die Marmorstufen hinauf, und als sie bei ihrer Mutter ankam, nahm sie ihre weiche schuppige Hand und küsste sie. Es war eine formale, aber keine versöhnliche Geste.“ Olivia heißt die Frau, die nach langen Jahren in Australien zurück nach Frankreich und zu ihrer Mutter kehrt. Nach einer gescheiterten Ehe mit einem brutalen Mann, den ihre Mutter, eine strenge Patriarchin, immer schon für den Falschen hielt.
Einmal im vermeintlichen Zuhause angekommen, wird die gesamte weitere Handlung des schmalen Romans, der eher einer Novelle gleicht, sich innerhalb der Mauern des Familienbesitzes abspielen. Eine räumliche Enge mit klaustrophobischen Zügen, welche die inneren, seelischen Beengungen der Figuren vortrefflich spiegelt.
Unheimliche Familiengeschichte
Was Julia Leigh hier vor den Lesenden ausbreitet, ist dem Sujet nach eigentlich eine Familiengeschichte. Erzählt mit Mitteln, die an eine Gothic Novel erinnern. Das ist irritierend, Irritation und Verstörung wollen gar nicht mehr aufhören. Es stellt sich die Frage, in welcher Zeit man sich eigentlich befindet, im 18. oder 19. Jahrhundert – das Schloss, die Bediensteten, der strenge Verhaltenskodex; aber die Überwachungskamera, das Handy, nein, wir sind am Anfang des dritten Jahrtausends.
Wir ahnen die körperliche Gewalt, der die Frau, Olivia, ausgesetzt war, wir müssen sie dann zur Kenntnis nehmen: Erst der Arm in der Schlinge gleich zu Beginn, dann die Blutergüsse an den Oberschenkeln, die die Lesenden ebenso wie die Kinder mit einem Blick erhaschen, als die Frau mit hoch gerutschtem Rock auf dem Bett liegt. Leigh gibt klare Zeichen, aber sie erklärt sie nicht. Kein warum und woher. Kein erläuterndes Wort über die Beziehung Olivias zu ihrem Mann, was beide je verband, warum sie so lange bei ihm blieb. Die Dinge, die Geschehnisse sind konkret und doch unfassbar.
Bilden die Frau und ihre Kinder, der neunjährige Sohn und die fünfjährige Tochter, eine Art Mittelpunkt, so zieht sich eine unerhörte Begebenheit wie ein roter Faden durch die Erzählung: Am Tag der Ankunft Olivias werden ihr Bruder, dessen Frau Sophie und deren Neugeborenes erwartet. Doch das Kind stirbt bei der Geburt – und Sophie trägt das tote Kind nun viele Tage durch das Haus, nimmt es mit zu den Mahlzeiten; bewahrt es nachts im Kühlschrank auf, versucht, es zu stillen, und weigert sich, es beerdigen zu lassen. Leigh schildert so unheimliche wie abstruse Szenen, Bilder von präziser, filmischer Ausdruckskraft. Sie entwickelt einen ungeheuren erzählerischen Sog.
Unterschwellig vibrieren die seelischen Kränkungen, die Versehrtheiten aller Figuren. Auch die verschiedenen Arten von Gewalt, die sie sich gegenseitig zufügen. Unvermittelt brechen Emotionen dann fast triebartig hervor. Es ist eine Familiengeschichte, die wie ein einziger, nicht endender Alptraum wirkt – und Leigh benutzt Bilder und Verdichtungen wie sie Träumen zu Eigen sind. Dazu fügt sich, dass sie oft nur von „der Frau“, „dem Kind“ schreibt, als wären sie Prototypen des Unbewussten – dies mindestens genauso wie individuelle Persönlichkeiten.
Überraschende Reverenz an Ingeborg Bachmann
Dieses Merkmal allein wäre noch kein Grund, an eine berühmte Schriftstellerkollegin zu denken, aber Julia Leigh forciert die Bezugnahme auf Ingeborg Bachmann mehrfach – und sie überrascht zunächst.
„Avec ma main brûlée, j`écris sur la nature du feu“, dieses abgewandelte Flaubert-Zitat stammt aus Bachmanns Roman Malina und Julia Leigh stellt es ihrem Buch als eine Art Motto voran. Man ist also auf die Spur gesetzt und muss erneut an Bachmanns bekannten, 1971 erschienenen Roman denken, wenn es von „der Frau“ später heißt: „»Meine Ermordung«, sagte sie »habe ich selbst ermöglicht, das ist es, was es unerträglich macht.«“ Denn „Es war Mord“ lautet der letzte Satz in Malina, nachdem das weibliche Ich in einer Wand „verschwunden“ ist. Von seinem Mörder spricht dieses Ich ebenso wie Olivia mehrfach über ihren Mann spricht – dennoch kann diese sich nur schwer beherrschen, ihn, ihren Mörder, nicht anzurufen: Auch bei Bachmann hat das Telefon eine fast magische Wirkung – und stellte eine Verbindung zwischen dem weiblichen Ich und seinem „Mörder“ dar.
Malina war damals ein verstörender Roman, ist es bis heute. Das liegt auch an seinen so kryptischen wie expliziten Szenerien, Bachmann greift auf Traumerzählungen zurück, schildert Alpträume der Ich-Erzählerin von ihrem Vater, der Schwester, in denen die familiären, auch sexuellen Verheerungen brutal zu Tage treten. Andere Passagen sind wie ein Märchen erzählt. Bei Julia Leigh verbinden sich diese Elemente in einem Erzählfluss: Ihre Novelle ist reale Erzählung, beklemmender Traum und düsteres Märchen in einem.
Dass sich die psychischen wie physischen Gewaltverhältnisse in Familien, in sogenannten Liebesbeziehungen, die verhängnisvollen Verstrickungen und Abhängigkeiten zwischen allen Beteiligten – insbesondere zwischen „Opfern“ und „Tätern“ – nicht in einer nur realen, auf Verständigung abzielenden Erzählweise darstellen lassen, darin scheint Ingeborg Bachmann für Julia Leigh so anziehend und auch modern zu sein. Die „Unruhe“, die ihrem Buch den Titel gab, ist unheimlich, nur mit dem Verstand nicht zu bändigen – so ergeht es allen, die sie erfasst. Und will man die Beziehungen in diesem Buch beschreiben, so ist in ihnen eine Zerstörungskraft angelegt, die unheilbare Wunden hinterlässt, da gibt es nichts schönzureden – darin ist Julia Leigh ebenso radikal und beunruhigend wie Ingeborg Bachmann.
Carola Ebeling
Julia Leigh: Unruhe (Disquiet, 2008).
Liebeskind 2009. 128 Seiten. 14,90 Euro.











