 Meisterwerk? – Hier wird beleuchtet und argumentiert!
Meisterwerk? – Hier wird beleuchtet und argumentiert!
Kenneth Millar, verheiratet mit der großen Margaret Millar, aka Ross Macdonald (1915 – 1983) ist einer der Klassiker der us-amerikanischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Alf Mayer hat ihn als Vorbereitung zu unserem Klassiker-Check einläßlich eingeordnet.
Sein letzter Lew Archer-Roman, „Der blaue Hammer“ von 1976, ist gerne als sein „Meisterwerk“ gefeiert worden. Aber ist das wirklich so? Joachim Feldmann, Alf Mayer, Susanna Mende und Thomas Wörtche haben den Roman noch einmal mit frischem Blick gelesen.
Zuletzt im KlassikerCheck gewesen: Eric Ambler mit „Die Maske des Dimitrios“ und Charles Willeford mit „Miami Blues„.
Zwischen klassischer Tragödie und Häkelplot
Joachim Feldmann
Lew Archer ist ein Ermittler mit Manieren. Selbst wenn sich ein Auftraggeber als cholerischer Grobian entpuppt, bleibt er höflich und zurückhaltend, mag es ihn auch in den Fäusten jucken: „I felt like hitting him. Instead I turned on my heel and walked to the far end of the driveway.” Jack Biemeyer heißt der Mann, dem hier beinahe eine heftige Ohrfeige verpasst worden wäre. Eine Kupfermiene in Arizona hat ihn so reich gemacht, dass er sich ein Anwesen an der kalifornischen Küste leisten kann. Archer ist nicht beeindruckt: „It was more like a public building than a house – the kind of place where you go to pay your taxes or get a divorce“.
Man sieht, ausgefallene Bilder oder Metaphern sind ebenso wenig die Sache dieses Ich-Erzählers wie die Anwendung physischer Gewalt. Von Macdonalds Tendenz, „seine Texte mindestens partiell mit Anspielungen, Vergleichen und Bildern zu überfrachten“, die Jochen Schmidt in „Gangster – Opfer –Detektive“ („Typengeschichte des Kriminalromans“. Berlin. Ullstein 1989) bemängelt, ist in „The Blue Hammer“ wenig zu erkennen. Das unterscheidet Lew Archer von anderen Privatermittlern der US-amerikanischen Tradition. Aber er ist hartnäckig, auch wenn es nur um ein Bild von zweifelhaftem Wert geht, dass den Biemeyers gestohlen wurde. Angeblich stammt es von dem seit einem Vierteljahrhundert verschollenen Maler Richard Chantry. Auskunft über die Herkunft des Kunstwerks könnte ein Galerist namens Paul Grimes geben, doch der wird ermordet, bevor Archer ihn befragen kann. Und es bleibt nicht bei einem Toten.
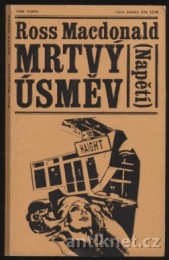 „The Blue Hammer“ ist der letzte von achtzehn Lew-Archer-Romanen, die Ross Macdonald zwischen 1949 und 1976 veröffentlichte. Und zum wiederholten Mal geht es um einen Fall von klassischer Tragödienqualität. Mancher mag sich aber auch an die feingehäkelten Plots klassischer britischer Detektivromane erinnert fühlen. Während Archer versucht, sich in einem komplizierten Gebäude von Lügen und Halbwahrheiten zurechtzufinden, wähnt sich der Leser bereits der Lösung auf der Spur, um am Ende doch eines Besseren belehrt zu werden. Daher empfiehlt sich die wiederholte Lektüre der letzten beiden Kapitel des Romans, in denen die verhängnisvolle Geschichte, die mehr als dreißig Jahre zuvor mit einem Brudermord, der keiner war, beginnt, rekonstruiert wird. Hier findet sich auch die Erklärung für den seltsamen Titel des Buches: Einen „blauen Hammer“ erkennt Archer in dem an der Schläfe sichtbaren Pulsschlag einer schlafenden jungen Frau, in die sich der Detektiv verliebt hat. Und er bedeutet, dass sie lebt, während jene Figuren, die direkt in den Fall verwickelt sind, zu einer Art Scheinexistenz verurteilt waren. Bei entsprechendem philologischem Aufwand ließe sich diese Textstelle sicherlich als Ausgangspunkt für eine treffliche Interpretation des Romans nutzen. Nicht umsonst genießt Ross Macdonald in literaturwissenschaftlichen Zirkeln ein hohes Renommee. Ob seine Romane allerdings, um noch einmal Jochen Schmidt zu zitieren, „zum Spannendsten und Erregendsten gehören, was die Literatur der sechziger und siebziger Jahre zu bieten hatte“, erscheint mir inzwischen doch als ziemlich übertriebenes Urteil.
„The Blue Hammer“ ist der letzte von achtzehn Lew-Archer-Romanen, die Ross Macdonald zwischen 1949 und 1976 veröffentlichte. Und zum wiederholten Mal geht es um einen Fall von klassischer Tragödienqualität. Mancher mag sich aber auch an die feingehäkelten Plots klassischer britischer Detektivromane erinnert fühlen. Während Archer versucht, sich in einem komplizierten Gebäude von Lügen und Halbwahrheiten zurechtzufinden, wähnt sich der Leser bereits der Lösung auf der Spur, um am Ende doch eines Besseren belehrt zu werden. Daher empfiehlt sich die wiederholte Lektüre der letzten beiden Kapitel des Romans, in denen die verhängnisvolle Geschichte, die mehr als dreißig Jahre zuvor mit einem Brudermord, der keiner war, beginnt, rekonstruiert wird. Hier findet sich auch die Erklärung für den seltsamen Titel des Buches: Einen „blauen Hammer“ erkennt Archer in dem an der Schläfe sichtbaren Pulsschlag einer schlafenden jungen Frau, in die sich der Detektiv verliebt hat. Und er bedeutet, dass sie lebt, während jene Figuren, die direkt in den Fall verwickelt sind, zu einer Art Scheinexistenz verurteilt waren. Bei entsprechendem philologischem Aufwand ließe sich diese Textstelle sicherlich als Ausgangspunkt für eine treffliche Interpretation des Romans nutzen. Nicht umsonst genießt Ross Macdonald in literaturwissenschaftlichen Zirkeln ein hohes Renommee. Ob seine Romane allerdings, um noch einmal Jochen Schmidt zu zitieren, „zum Spannendsten und Erregendsten gehören, was die Literatur der sechziger und siebziger Jahre zu bieten hatte“, erscheint mir inzwischen doch als ziemlich übertriebenes Urteil.

Jedes Wort zählt
Alf Mayer
Wieder und wieder in der Vergangenheit zu schürfen, das mag 2016 nicht mehr so ganz zeitgemäß sein. „Der blaue Hammer“ von 1976 stellt vieles in den Schatten, was wir heute an Zwiebelschichten eines Kriminalromans gewohnt sind. Es war Ross Macdonalds letzter Roman, 61 Jahre alt war er bei Erscheinen. Als er mit 68 an Alzheimer starb, hatte er gar nicht mehr gewusst, was Schreiben war. „Broken…. broken…“ waren seine letzten gekritzelten Worte gewesen. Zerbrochen, zerschellt…
In seinen insgesamt 24 Romanen (18 davon mit Lew Archer) gibt es noch wildere Verwicklungen als die schön symmetrisch gebaute Geschichte über ein verschwundenes Gemälde, die in einer hoch über dem fiktiven Santa Teresa trohnenden Villa anfängt und in ein verkommenes Anwesen in der Wüste von Arizona führt. Die Spiegelung der sich immer deutlicher manifestierenden Vergangenheit in ein paar Gemälden ist ein schöner Touch: die Bilder, die man sich von etwas macht; die Rahmen, in die man etwas stellt und fügt; die Definitionen, die man von einander hat. Lew Archers Kommentarstimme ist so etwas wie eine soziologische Rahmenanalyse im Sinne Erving Goffmans. Und natürlich bestimmt bei ihm die Sprache das Setting entscheidend mit.
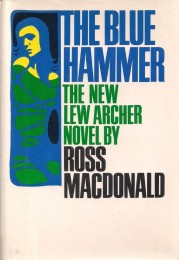 Aus fleischfressend wird übergriffig – das verharmlost
Aus fleischfressend wird übergriffig – das verharmlost
Ich habe „The Blue Hammer“ mit großem Spaß im Original wiedergelesen und nur gelegentlich verglichen. Mein Eindruck ist, dass die Neuübersetzung von Karsten Singelmann die sehr ökonomisch gesetzten Schärfenziehungen Macdonalds nicht sonderlich herausarbeitet, sie eher einebnet oder Intentionen gar verkennt, aus welchen Gründen auch immer. Macdonald schwelgt nicht so überschwänglich in Metaphern wie Chandler, er tupft seine Bilder und Adjektive pointiert. Mit Widerhaken-Qualität. Nehmen wir das Wort „carnivorous“. Ab Seite 28 ist Lew Archer bei den Eltern des Studenten, der mit der Tochter seiner Auftraggeberin zusammen ist und im Verdacht steht, das vermisste Gemälde entwendet zu haben. (Davor hatte es schon die Frau des seit langer Zeit verschwundenen Malers und dessen Abschiedsbrief gegeben, bei Ross Macdonald geschieht die Exposition stets zügig – umso wichtiger ist dabei jedes weiterdeutend charakterisierende Wort.) Er spricht mit der Mutter des jungen Mannes, einer Krankenschwester, die ihren invaliden Mann gefangen zu halten scheint, und es kommt zu folgender Passage:
„Das mit Jerry, meinen Sie? Ja, mir tut das auch leid. Früher war er ein wirklich stattlicher Mann. Aber vor einiger Zeit hatte er einen Nervenzusammenbruch – kommt alles noch vom Krieg -, und seitdem ist er nicht mehr der Alte. Außerdem hat er natürlich ein Alkoholproblem. Wie viele von denen“, fügte sie nachträglich hinzu.
Mir gefiel die Offenherzigkeit der Frau, auch wenn sie etwas Übergriffiges hatte. Wie kam es wohl, überlegte ich müßig, dass so viele Krankenschwestern einen invaliden Mann zu Hause hatten?
Übergriffig? Ross Macdonald schreibt „slightly carnivorous“, etwas leicht Fleischfressendes. Auch Offenherzigkeit für „candor“ legt ein Herz dahin, wo es keines gibt – wie wir lernen werden – und wo Offenheit genügt hätte. Zu Hause haben ist schwächer als das Schicksalshafte „mit einem invaliden Mann enden“, solche Zuschreibungen sind bei Macdonald ebenso wichtig wie die am Haus dieses Paares blätternde Fassade. Dieses sich gegenseitig verzehrende Paar, dessen Verkettung hier in einigen wenigen Schattenworten aufscheint, ist der Angelpunkt der Romans. Achtung, Spoiler: Lew Archer wird hierhin am Ende seiner Suche zurückkehren, und ein mörderischer Vater wird das tränennasse Gesicht eines mörderischen Sohnes in den Händen halten. Hier das Original:
„About Jerry, you mean? Yeah, I’m sorry, too. He used tob e a fine strong man. But he had a nervous breakdown a while ago – it all goes back to the war – and he’s never been the same since. And of course he has a drinking problem, too. So many of them do,“ she added meditavely.
I liked the woman’s candor, even though it sounded slightly carnivorous. I wondered idly how it was that nurses often ended up with invalid husbands.
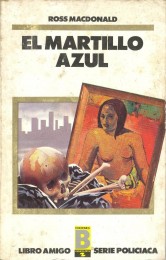 Wir verglichen nicht nur unsere Notizen
Wir verglichen nicht nur unsere Notizen
Die „erotische Forschheit einer ausgehungerten Witwe“ ist etwas anderes als „an angry widowed sexualtiy“ (Seite 28 dtsch/ 18 Original). Unterdrückte, aber in der Übersetzung abgeschwächte Wut gibt es auch bei dem Paar der Eingangsszene. Ruth Biemeyer, die Archers Suche angestoßen, von seinen Nachforschungen aber zunehmend enerviert ist, folgt in Kapitel 28 nicht ihrem Schatten einfach ins Zimmer, sie zertrampelt ihn mit ihren Absätzen („moved into the doorway, trampling on the heels of her own shadow“). Die unterschwellige Aggression wird in der Übersetzung abgemildert. Die der Frau in den Ehejahren gewachsene Schutzschicht ist einfach „Narbengewebe“, ohne das Beiwort „hässlich“, das die Übersetzung hinzufügt, wäre es wirkungsvoller.
1976 war die Evokation des Erotischen noch etwas Delikates, Ross Macdonald war da behutsam, aber genau und elegant. Eine rassige dunkelhaarige Frau in einer Kunstgalerie zum Beispiel wird in der Übersetzung ziemlich entschärft. „Haarflaum bedeckte ihre rundlichen brauen Arme wie ein Schleier.“ Ihhh. Die runden Arme stehen im Original einen Satz höher, in einem anderen Zusammenhang, und die Haare züngeln an ihnen wie feiner Rauch, bedecken nicht einfach: „The light growth of hair on her arms looked like clinging smoke.“
Lew Archer bandelt mit der Journalistin Betty Jo an, schreibt einmal sogar „Love, Lew“, und hat mit ihr eine der schönsten Bettszenen der Kriminalliteratur. Die Kürze der Beschreibung ist ein klassischer Ross Macdonald:
„I returned to my motel. Betty Jo came in with me to compare notes. We compared not only notes.
The night was sweet and short. Dawn slipped in like something cool and young and almost forgotten.“
Die Übersetzung macht daraus:
„Wir fuhren zu meinem Motel zurück. Betty Jo kam noch mit aufs Zimmer, um Informationen auszutauschen. Wir tauschten dann nicht nur Informationen aus.
Die Nacht war süß und kurz. Der Morgen kam auf leisen Sohlen, als etwas Frisches, Junges und fast Vergessenes.“
Volle zehn Punkte für Teil zwei, den Morgen. Aber Informationen, das ist weder sexy noch frivol.
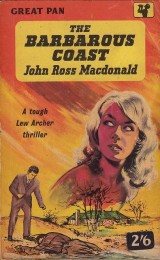

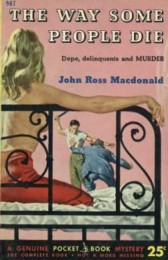 Ein Namensvetter ist anhaltend beleidigt
Ein Namensvetter ist anhaltend beleidigt
John D. MacDonald übrigens, der Autor der Travis McGee-Romane, beschwerte sich beim Verlag Alfred A. Knopf über den Titel „The Blue Hammer“, suchte ihn zu verhindern, weil das eine parasitäre Annäherung an seine stets mit Farben spielenden Titel sei („Abschied in Dunkelblau“, „Zimtbraune Haut“, „Der grüne Tod“ usw.) und nannte die Titelgebung „ a pretty dumb thing to do“. Es war der zweite, recht dumme Brief, mit dem der eine MacDonald auf den anderen – in den Verkaufszahlen weit hinter ihm liegenden, in den Feuilletons aber weit geachteteren – reagierte. Der erste Brief war 1949 beim Verlag eingegangen, als „The Moving Target“ (Reiche sterben auch nicht anders) unter dem Pseudonym John Macdonald veröffentlicht worden war. Kenneth Millar – wie Ross Macdonald eigentlich hieß – hatte die ersten zwei Namenbestandteile seines früh aus seinem Leben verschwundenen schottisch stämmigen Vaters John Macdonald Millar verwendet. Der gleichaltrige John D. MacDonald hatte bis dahin nur Pulp-Geschichten veröffentlicht, noch keinen Roman, sah sich aber geschädigt. Kenneth Millar und sein Verlag Alfred A. Knopf – so etwas wie Suhrkamp, verglichen mit Bastei-Lübbe – variierten daraufhin die nächsten Romane mit John R. Macdonald, John Ross Macdonald, bis es dann eben bei Ross Macdonald blieb.
Ob es an John D. MacDonald, 1962 Präsident der Mystery Writers of America, alleine lag, dass sein Namensvetter nur ein einziges Mal für einen „Edgar“ nominiert wurde, den wichtigsten Krimi-Preis der Welt aber nie erhielt, ist unbekannt. Auch Ed McBain/ Evan Hunter, ebenfalls nie mit einem „Edgar“ ausgezeichnet, konnte seltsame Geschichten über das Auswahlkomitee erzählen.
Lebenslang missgünstig blieb auch Raymond Chandler, der sich imitiert fand – was vielleicht auf die ersten zwei Romane Kenneth Millars von 1944/45 zutreffend mag. 1962 wurden die Briefe „Raymond Chandler Speaking“ veröffentlicht, darin ein böses Schreiben von 1949 an James Sandoe über „The Moving Target“. Ross Macdonald, danach befragt, antwortete trocken: „Writing well is the best revenge.“ – Gut zu schreiben ist die beste Revanche.
Gut geschrieben, das hat er, dieser Autor. Eine Freude, ihn wieder zu lesen.
 Ausgefuchst & brillant, aber holprig übersetzt
Ausgefuchst & brillant, aber holprig übersetzt
Susanna Mende
Der blaue Hammer ist der letzte Roman der achtzehn Bände umfassenden Reihe um den Privatermittler Lew Archer, die Ross Macdonald mit langem Atem und ebensolchem Erfolg über den Zeitraum von 27 Jahren hinweg, zwischen 1949 und 1976, geschrieben hat.
Ross Macdonald, alias Ken Millar, wird gern – und nicht zu Unrecht – in einem Atemzug mit Raymond Chandler und Dashiell Hammett genannt, der sogenannten Heiligen Dreieinigkeit der Hardboiled-Autoren, deren Romane hauptsächlich in Kalifornien angesiedelt sind. Macdonald gab allerdings Chandler den Vorzug vor Hammett, was bei den frühen Titeln aus der Archer-Reihe nicht zu übersehen ist, obwohl er den prägnanten Chandler’schen Zynismus später gegen eine ordentliche Portion Mitgefühl und Engagement seines Helden für seine neurotischen Mit- und Gegenspieler eintauscht. Außerdem handelt es sich bei Macdonalds Romanen um das Kalifornien der Nachkriegszeit, das schneller und gieriger geworden ist. Und seine Plots sind so raffiniert und vielschichtig, dass sie mehr an eine Rätselstruktur als an einen Whodunit erinnern.
Dabei galt Macdonald das Schreiben von Kriminalromanen zu Beginn seiner schriftstellerischen Laufbahn als Brotjob, etwas, das er nur so lange tun wollte, bis er einen „richtigen“ Roman bei einem Verlag unterbringen könnte. Was jedoch nicht bedeutete, dass er Kriminalromane literarisch als minderwertig betrachtete, etwas, das in den 50er Jahren in den USA durchaus gängige Meinung war. Macdonald war, wie auch seine Frau Margaret Millar, die schon vor ihm Erfolg als Autorin von Kriminalromanen hatte, von Anfang an ein großer Fan des Genres.
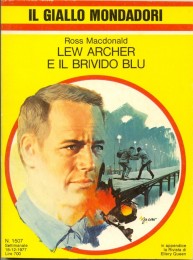 Dass er schließlich doch dabei geblieben ist, obwohl seine Ambitionen mehrere Jahre lang in eine andere Richtung gingen, hat womöglich auch damit zu tun, dass seine bevorzugten Themen wunderbar mit dem Aufklären von Verbrechen zu kombinieren waren; verschwundene Objekte oder Personen sind zu finden, auf den ersten Blick unmotivierte Morde zu klären, Familiengeheimnisse zu lüften und neurotisches oder anderweitig krankhaftes Verhalten zu ergründen, wobei der Ursprung des Übels meist innerhalb der Familie zu finden ist; Verfehlungen gegenüber den Nächsten und Liebsten in Variation, die die nachfolgenden Generationen unvermeidlich einholen und ins Unglück stürzen, oder gar von Beginn ihres Lebens an einen Schatten auf sie werfen, den sie nicht mehr loswerden. Dabei nimmt die schuldhafte Verstrickung der Protagonisten, aus der sie sich nicht mehr befreien können oder wollen, manchmal die Dimension einer griechischen Tragödie an.
Dass er schließlich doch dabei geblieben ist, obwohl seine Ambitionen mehrere Jahre lang in eine andere Richtung gingen, hat womöglich auch damit zu tun, dass seine bevorzugten Themen wunderbar mit dem Aufklären von Verbrechen zu kombinieren waren; verschwundene Objekte oder Personen sind zu finden, auf den ersten Blick unmotivierte Morde zu klären, Familiengeheimnisse zu lüften und neurotisches oder anderweitig krankhaftes Verhalten zu ergründen, wobei der Ursprung des Übels meist innerhalb der Familie zu finden ist; Verfehlungen gegenüber den Nächsten und Liebsten in Variation, die die nachfolgenden Generationen unvermeidlich einholen und ins Unglück stürzen, oder gar von Beginn ihres Lebens an einen Schatten auf sie werfen, den sie nicht mehr loswerden. Dabei nimmt die schuldhafte Verstrickung der Protagonisten, aus der sie sich nicht mehr befreien können oder wollen, manchmal die Dimension einer griechischen Tragödie an.
Wie so oft bei Macdonald beginnt auch Der blaue Hammer mit einem scheinbar einfachen Auftrag für den Privatermittler Archer: Er soll für die Gattin eines Industriemagnaten ein aus dem Museum verschwundenes Gemälde wiederbeschaffen. Und wie so oft erweisen sich fast alle Personen, mit denen Archer in Kontakt kommt, von Anfang an als entweder gestört, frustriert, angstgetrieben oder desillusioniert. Keiner ist unbelastet, jeder schleppt etwas mit sich herum, versucht etwas zu verbergen oder – auch mit unlauteren Mittel – zu bekommen. Als er sich schließlich auf die Suche nach dem dreißig Jahre zuvor verschwunden Maler macht, beginnt sich der Fall stark zu verästeln, vor allem als ein weiterer Mord geschieht und ein angeblich natürlicher Tod sich als Mord erweist.
Die Konstruktion des Falles und vor allem seine überraschende Auflösung sind ziemlich ausgefuchst. Auch wenn Macdonald hier den Bogen fast ein wenig überspannt, ist Der blaue Hammer trotzdem ein brillanter Abschluss der Reihe, von der zwei Romane mit Paul Newman als Detektiv verfilmt wurden (Harper 1966 und The Drowning Pool 1975).
 Der Diogenes Verlag, der seit 1970 die Romane auf Deutsch herausgibt, hat in jüngster Zeit drei Titel in den Neuübersetzungen von Karsten Singelmann veröffentlicht. Es ist sehr verdienstvoll, wenn Verlage sich der Klassiker des Genres annehmen, und der Verlag wirbt auch damit. Enttäuschend ist nur, dass die Übersetzung doch zahlreiche Mängel aufweist, sowohl was die Korrektheit der Übersetzung (siehe Kritik von Alf Mayer) als auch Sprache und Stilsicherheit im Deutschen betrifft. So ist in den Dialogen das Sprachniveau der Personen häufig inkonsistent und schwankt zwischen ausgesprochen förmlich und flapsig. Es gibt zahlreiche schiefe Bilder und falsch benutzte feste Wendungen (Man kann sich nicht selbst etwas vorbeten, schon gar nicht, indem man einen Brief liest, und man nimmt dem anderen auch nicht einen Punkt im Spiel ab, man macht höchstens einen. Und wenn der „heruntergekommenen Unterstadt“ – wer sagt heute noch Unterstadt in einer Übersetzung? – gleich im nächsten Satz „heruntergekommene Menschen“ folgen, ist das eine unschöne Wiederholung. Wenn man liest „das Haus war eine ausladende Angelegenheit aus weißem Putz“ frage man sich augenblicklich, wie die „Angelegenheit“ wohl im Original heißt, denn das ein Haus als Angelegenheit bezeichnet werden kann, ist doch stark zu bezweifeln. Leider ziehen sich diese Holprigkeiten durch die gesamte Übersetzung, was den Lesegenuss durchaus schmälert. Dabei ist Ross Macdonald einer der Großen des Genres, der zahlreiche Autoren beeinflusst hat und es verdient, immer wieder gelesen zu werden.
Der Diogenes Verlag, der seit 1970 die Romane auf Deutsch herausgibt, hat in jüngster Zeit drei Titel in den Neuübersetzungen von Karsten Singelmann veröffentlicht. Es ist sehr verdienstvoll, wenn Verlage sich der Klassiker des Genres annehmen, und der Verlag wirbt auch damit. Enttäuschend ist nur, dass die Übersetzung doch zahlreiche Mängel aufweist, sowohl was die Korrektheit der Übersetzung (siehe Kritik von Alf Mayer) als auch Sprache und Stilsicherheit im Deutschen betrifft. So ist in den Dialogen das Sprachniveau der Personen häufig inkonsistent und schwankt zwischen ausgesprochen förmlich und flapsig. Es gibt zahlreiche schiefe Bilder und falsch benutzte feste Wendungen (Man kann sich nicht selbst etwas vorbeten, schon gar nicht, indem man einen Brief liest, und man nimmt dem anderen auch nicht einen Punkt im Spiel ab, man macht höchstens einen. Und wenn der „heruntergekommenen Unterstadt“ – wer sagt heute noch Unterstadt in einer Übersetzung? – gleich im nächsten Satz „heruntergekommene Menschen“ folgen, ist das eine unschöne Wiederholung. Wenn man liest „das Haus war eine ausladende Angelegenheit aus weißem Putz“ frage man sich augenblicklich, wie die „Angelegenheit“ wohl im Original heißt, denn das ein Haus als Angelegenheit bezeichnet werden kann, ist doch stark zu bezweifeln. Leider ziehen sich diese Holprigkeiten durch die gesamte Übersetzung, was den Lesegenuss durchaus schmälert. Dabei ist Ross Macdonald einer der Großen des Genres, der zahlreiche Autoren beeinflusst hat und es verdient, immer wieder gelesen zu werden.

Gezähmt oder subversiv? Oder beides?
Thomas Wörtche
Es liegt schon fast ein Gottfried Kellersches „güldenes Abendlicht“ über dem letzten Lew-Archer-Roman von Ross Macdonald. Die Ära des klassischen Dreifaltigkeit Hammett – Chandler – Macdonald ist endgültig erloschen, die nächste Generation der Privatdetektiv-Schreiber wie Robert B. Parker, Arthur Lyons, Robert W. Campbell oder Loren D. Estleman macht ihre ersten Gehversuche oder scharrt noch mit den Hufen.
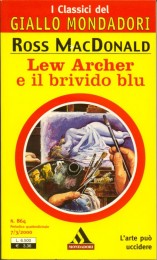 Eine milde Mattigkeit scheint den „Blauen Hammer“ zu durchziehen. Lew Archer grübelt über Sinnfragen, verliebt sich in eine junge Frau und sieht darin sogar eventuell eine Perspektive. Das Tempo ist gemächlich, die sprachliche Inszenierung von altmeisterlicher Gediegenheit, die Action zurückhaltend. Der Zeitgeist spielt ein wenig mit: Drogen, eine Outdrop-Kommune, Toleranz für Schwule, ohne dass sich Macdonald jedoch an irgendwelche Aktualitäten anbiedert oder vorgibt, „heiße Eisen“ anzupacken. Das ist so souverän wie sympathisch.
Eine milde Mattigkeit scheint den „Blauen Hammer“ zu durchziehen. Lew Archer grübelt über Sinnfragen, verliebt sich in eine junge Frau und sieht darin sogar eventuell eine Perspektive. Das Tempo ist gemächlich, die sprachliche Inszenierung von altmeisterlicher Gediegenheit, die Action zurückhaltend. Der Zeitgeist spielt ein wenig mit: Drogen, eine Outdrop-Kommune, Toleranz für Schwule, ohne dass sich Macdonald jedoch an irgendwelche Aktualitäten anbiedert oder vorgibt, „heiße Eisen“ anzupacken. Das ist so souverän wie sympathisch.
Der Plot folgt der üblichen Macdonald-Routine, bei der man grübeln darf, ob sie wirklich so „psychoanalytisch“ vorgeht, wie man gerne hin und wieder liest: Aus einem aktuellen Fall für Archer wird ein fast vierzig Jahre zurückliegendes Familiendrama, dessen Kreis sich wieder in der Jetztzeit schließt. Sein Großprojekt, die Psychopathologie der Familie, seine hartnäckige und radikale Zersetzungskampagne gegen einen der heiligsten amerikanischen Werte, gegen die family values, hat Ross Macdonald bis zum Ende mit leiser, aber effektiver subversiver Energie durchgezogen. Familie und Beziehungen sind bei ihm immer noch hochsuspekt, kriminogene Zonen und gleichzeitig Ziel utopischer Wünsche und Träume, gegen die auch Archer nicht immun ist und sich am Ende – wider besseres Wissen – eventuell gar ergibt. Man kann das als Resignation lesen oder eben als Vorschein eines besseren und trotzigen „Dennochs“.
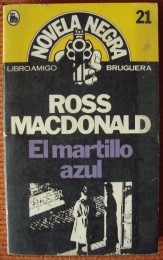 Klar könnte man am „Blauen Hammer“ herumnörgeln: zu komplex die Geschichte vom verschwundenen Maler, der am Ende wieder da und dann doch ein anderer ist. Zu verwickelt die Wer-mit-wem-und-wann-und-warum- und wie Wer-ist-in-Wirklichkeit-Wer-Konstellation, die man aber dennoch nicht mit den üblichen Whodunit-Puzzles verwechseln darf. Trotzdem entsteht dann zum Ende hin ein struktureller Sachzwang – denn auch Ross Macdonald muss, um auf eine überraschendes Ende, einen finalen Twist zu kommen, die Plausibilität arg beugen, um alle vorher angelegten Elemente dann säuberlich zu fügen. Wobei das Ende des Romans schon fast rührend gelungen ist, der Weg dorthin ist allerdings bisweilen arg steinig und zäh. Das liegt natürlich auch an dem epischen Konzept von Macdonald, das sich weit von den Ursprüngen der schnellen, kleinen, schmutzigen hard-boiled-detective-novel entfernt hat und den Privatdetektiv zur Hauptfigur eines schon fast bürgerlich zu nennenden, voll ausgebauten, seriösen Mainstream-Romans macht. Man kann darin eine Zähmung des populärkulturellen Ansatzes sehen. Aber: Auch wenn fast alle pulp-Elemente getilgt sind, so bleibt doch der subversive Impetus fast paradoxerweise erhalten. Insofern ist der „Blaue Hammer“ in der Tat ein Buch der Zeitenwende.
Klar könnte man am „Blauen Hammer“ herumnörgeln: zu komplex die Geschichte vom verschwundenen Maler, der am Ende wieder da und dann doch ein anderer ist. Zu verwickelt die Wer-mit-wem-und-wann-und-warum- und wie Wer-ist-in-Wirklichkeit-Wer-Konstellation, die man aber dennoch nicht mit den üblichen Whodunit-Puzzles verwechseln darf. Trotzdem entsteht dann zum Ende hin ein struktureller Sachzwang – denn auch Ross Macdonald muss, um auf eine überraschendes Ende, einen finalen Twist zu kommen, die Plausibilität arg beugen, um alle vorher angelegten Elemente dann säuberlich zu fügen. Wobei das Ende des Romans schon fast rührend gelungen ist, der Weg dorthin ist allerdings bisweilen arg steinig und zäh. Das liegt natürlich auch an dem epischen Konzept von Macdonald, das sich weit von den Ursprüngen der schnellen, kleinen, schmutzigen hard-boiled-detective-novel entfernt hat und den Privatdetektiv zur Hauptfigur eines schon fast bürgerlich zu nennenden, voll ausgebauten, seriösen Mainstream-Romans macht. Man kann darin eine Zähmung des populärkulturellen Ansatzes sehen. Aber: Auch wenn fast alle pulp-Elemente getilgt sind, so bleibt doch der subversive Impetus fast paradoxerweise erhalten. Insofern ist der „Blaue Hammer“ in der Tat ein Buch der Zeitenwende.
PS: Der blaue Hammer ist eine kleiner Ader an der Schläfe, der pocht und damit anzeigt, dass der entsprechende Mensch noch lebt. Auch das durchaus ein hübsches kleines Symbol, das der Interpretation offen steht.
Letzte deutsche Ausgabe:
Ross Macdonald: Der blaue Hammer (The Blue Hammer, 1976). Dt. von Karsten Singelmann. Zürich: Diogenes 2013. 417 Seiten, Hardcover Broschur, 14,90 Euro.












