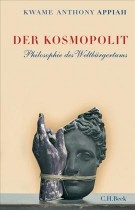 Weltbürger sein
Weltbürger sein
Sich dem Anderen und Fremden neugierig zu öffnen ist für Appiah nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern immer auch eine intellektuelle Herausforderung. Und es reicht ihm nicht, nur freundlich gegenüber den Armen in aller Welt zu sein.
Als die Studenten in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts für das Proletariat und die Weltrevolution auf die Straßen gingen, wünschte sich ein Politikprofessor in Heidelberg nichts sehnlicher als ein Bürger zu sein. Es sei an der Zeit, so schrieb Dolf Sternberger damals, „den Begriff des Bürgers zu rehabilitieren, damit nämlich der Staatsbegriff und der Staat selber aus seiner Versteinerung erweckt werde.“ Heute, viele Jahrzehnte später, hat weder das Proletariat die Macht erlangt, noch hat die Weltrevolution stattgefunden und auch das Verschwinden des Bürgers wird immer noch beklagt. Dennoch spüren wir alle, daß sich etwas in der Welt verändert hat: sie dringt mit ihren unendlich vielen Kulturen, Sprachen, Lebensgewohnheiten, Bereicherungen und Bedrohungen immer mehr in unseren so vertrauten und geordneten Alltag hinein. Verängstigt suchen die einen sich diesem Globalisierungsprozeß mit einem Rückzug in die Grenzen der eigenen, oft sehr beengten Identität zu widersetzen, einschließlich einer latenten Abwehr des und der Fremden. Andere sehen mehr die Möglichkeiten und Bereicherungen einer multikulturellen Durchmischung unseres Alltags. Aber die Toleranz gegenüber dem Ungewohnten oder dem Lebensstil der Anderen, der Fremden kann auch mit desinteressierter Gleichgültigkeit einhergehen. Man läßt den anderen in Ruhe, will aber auch selber in Ruhe gelassen werden. Wer sich aber als ‚Weltbürger“ versteht, sucht das Gespräch mit dem Fremden, lernt wenigstens eine der großen Weltsprachen, läßt sich von fremden Traditionen verunsichern wie er auch selber mit seinen Ideen und Werten die Anderen beeinflussen will. Genau das ist das Grundanliegen des in London geborenen, in Ghana aufgewachsenen, in England als Philosoph ausgebildeten und heute im amerikanischen Princeton lehrenden Kwame Anthony Appiah. Soll es nicht, so argumentiert Appiah in seinem Buch, zu einer kriegerischen Konfrontation der verschiedenen großen und kleinen Kulturen der Welt kommen, die heute in fast jedem kleinen Dorf aufeinandertreffen, müssen die Menschen lernen, das Gespräch zu suchen. Nicht um die Unterschiede zwischen ihren sozialen, kulturellen, religiösen, geographischen Herkünften zu nivellieren, sondern um sich in ihrem Anderssein zu erkennen und zu akzeptieren. Um die Möglichkeit und Notwendigkeit eines neuen Kosmopolitismus mit Beispielen anzureichern, geht Appiah immer wieder zurück in seine afrikanische Kindheit. In der Kinsway Road von Kumasi in Ghana war die halbe Welt zu Hause: Inder, Libanesen, Syrer, Iren, Griechen, Ungarn, Engländer. Man lebte friedlich miteinander und es muß ein ununterbrochenes Gespräch innerhalb dieser Kulturvielfalt gewesen sein. Diese biographische Erfahrung des Autors liefert die Grundierung seines Plädoyers für ein ‚Weltbürgertum’.
„Eine Welt, in der Gemeinschaften sich klar gegeneinander abgrenzen, scheint keine ernsthafte Option mehr zu sein, falls sie dies denn jemals war… Nicht der Kosmopolitismus
ist harte Arbeit, sondern dessen Widerlegung.“
Sich dem Anderen und Fremden neugierig zu öffnen ist für Appiah nicht nur eine Herzensangelegenheit, sondern immer auch eine intellektuelle Herausforderung. Und es reicht ihm nicht, nur freundlich gegenüber den Armen in aller Welt zu sein.
„Eine wirklich kosompolitische Reaktion beginnt mit dem Versuch, die Frage zu klären, warum ein Kind ( etwa in Bangladesh ) stirbt. Weltbürgertums hat ebensosoviel mit Intelligenz und Neugierde zu tun wie mit Engagement.“
Man liest das alles, was dieser afrikanisch-europäisch-amerikanische Philosoph hier zur Begründung eines neuen Weltbürgertums anführt mit sehr viel Sympathie. Dreimal unterstreichen kann man seine Feststellung, daß „ein Glaubensbekenntnis, das die Besonderheit der Blutsverwandtschaft und der Gemeinschaft an die erste Stelle setzt, vielleicht eine Vergangenheit, aber gewiß keine Zukunft hat.“ Aber irgendwie bleibt dieses Plädoyer für einen der Welt und der Zukunft zugewandten Kosmopoliten auch blaß. Zu sehr werden die Differenzen zwischen den verschiedenen Weltkulturen, etwa im Rechtsverständnis, ausgeklammert, zu wenig werden alltägliche Konflikte im Zusammenleben der Menschen jenseits der Welt der Banker und Hochschulprofessoren thematisiert. Wenn aber nur dort die wahren Kosmopoliten anzutreffen sind, was taugt dann dieser Begriff?
Carl Wilhelm Macke
Kwame Anthony Appiah: Der Kosmopolit. Philosophie des Weltbürgertums. Aus dem Englischen übersetzt von Michael Bischoff, C.H. Beck-Verlag, 2007, 222. S.











