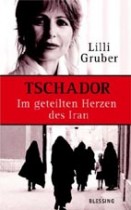 Pasolini in Teheran
Pasolini in Teheran
Die italienische Journalistin Lilli Gruber entdeckt den Iran
Vorurteile sind kein schlechter Lektürereiz. Sie können die Neugierde auf ein Buch wecken, weil man hofft, sie bestätigt zu finden oder sich von ihnen zu befreien. Wenn die italienische Starjournalistin Lilli Gruber ein Buch über den Iran mit dem gefühlvollen Titel „Tschador – Im geteilten Herzen des Iran“ veröffentlicht, dann hat man sogleich zwei Vorteile im Kopf. Wie soll eine so populäre Fernsehdiva wie die Gruber sich auskennen in einem Land. von dem vermutlich ein großer Teil der Leser auch nur Vorurteile besitzt? Auf dem Cover sieht man dann auch schon die gut geschminkte Top-Journalistin und eine Gruppe von Frauen, tief verhüllt im Tschador. Aber das Buch der Gruber bestätigt diese Vorurteile nicht. Weder liefert Lilli Gruber wie ihre, seit vielen Jahren in den USA lebende Reporterkollegin Oriana Fallaci Stoff en gros und en detail, um anti-islamische Gefühle anzustacheln noch verklärt sie die Schönheit von Land und Menschen und vergisst dabei die autoritäre Politik der Mullahs. Sie ist ganz einfach neugierig auf dieses Land und auf die Menschen, die sich hinter den Tschadors oder hinter fundamentalistischen Masken verbergen.
Vielleicht gehört der Iran heute zu den interessantesten Ländern der Welt, weil hier wie nur in wenigen anderen Regionen fast unbeweglich erscheinende Traditionen und eine Ultra-Moderne zusammenstossen. Lilli Gruber sieht diese Konfrontation ganz besonders bei den Frauen. Öffentlich unterwerfen sich viele Frauen noch den orthodoxen Erwartungen (zum Beispiel dem Tragen des Tschador), aber hinter den Türen zeigen sie ihre Vorlieben für westliche Modemarken. „Wenn man genauer unter den Tschador blickt, entdeckt man ein Universum von ausschweifenden Festen, sexuellen Kontakten, Drogen, Aids und ungewollten Schwangerschaften“. Ob das allerdings eine für den gesamten Iran geltende Beobachtung ist, kann man dem Buch nicht entnehmen. Lilli Gruber hat sich ohnehin stark auf die sozial besser gestellten urbanen Schichten der iranischen Gesellschaft konzentriert. Dort gibt es für die alten Mullahs und auch die juengeren Ultra-Konservativen um den Präsidenten Ahmadinedschad nur Spott und Ablehnung.
Sehr gut ist das Kapitel über die Repressionspolitik gegen einen unabhängigen, kritischen Journalismus, der sich heute immer mehr im Internet ausbreitet. „Worte und Frauen sind die eigentlichen Protagonisten auf der Bühne des Islam.“ Dass die italienische Autorinan einer Stelle ihrer journalistischen Momentaufnahmen aus dem heutigen Iran auch mit einem Restaurantbesitzer in Teheran über Pier Paolo Pasolini spricht, ist vielleicht nicht zufällig. Eine so sehr von kulturellen Widersprüchen gezeichnete Gesellschaft wie die iranische hätte Pasolini sicherlich zu großer kuenstlerischer Produktivität provoziert. Vielleicht gibt es Bücher, in denen fundierter über die Ursachen der vielen Widersprüche innerhalb der iranischen Gesellschaft aufgeklärt wird. Es mag auch sein, dass Lilli Gruber ihre Euphorie über die Formen einer Modernisierung zu rosig zeichnet. Auf jeden Fall aber hilft dieses Buch, bestehende Vorurteile über die iranische Gesellschaft von heute zu überprüfen. Und es macht sehr neugierig auf ein Land, dass Tag für Tag in den Schlagzeilen der Weltpresse steht. Wenn man den Iran einzig auf die „Atomfrage“ und den offenen Anti-Semitismus der gegenwärtigen politischen Mehrheit reduziert, wird man die Komplexität dieser Gesellschaft nicht verstehen.
„Die Menschen“, schreibt die Autorin ganz am Ende ihrer Aufzeichnungen, „denen ich im Iran begegnete, haben mich tief beeindruckt: Frauen mit und ohne Schleier und Männer, die an eine besser Zukunft glauben. Sie kämpfen Tag für Tag mutig und voll Hingabe für mehr Achtung. Sie glauben daran, es zu schaffen. Ich glaube es auch.“
Carl Wilhelm Macke
Lilli Gruber: Tschador – Im geteilten Herzen des Iran. Aus dem Italienischen von Friederike Hausmann. Karl Blessing Verlag, Muenchen 2006, 352 S.











