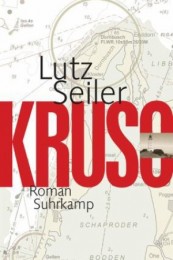 Es war noch nie so wie bei Kruso
Es war noch nie so wie bei Kruso
– Ist Lutz Seilers mit dem Buchpreis ausgezeichneter „Kruso“ wirklich ein Roman? Oder eher eine anthropologische Studie, die das Leben einer Außenseitertruppe auf Hiddensee aus der Perspektive eines hypersensiblen Trakl-Adepten beschreibt? Von Peter Münder
Als Tellerwäscher-SK (Saisonkraft) hatte Lutz Seiler, jetzt 51, auf der Insel Hiddensee im „Klausner“-Gasthof während des Wendesommers ’89 gearbeitet. Die damaligen Erfahrungen in dieser äußersten DDR-Ecke mit dem Blick aufs verheißungsvolle dänische Inselchen Møn – für einige Republikflüchtlinge das ultimative, erlösende Refugium – hatte Seiler damals zwar schon als potenzielles Romansujet abgespeichert, doch laborierter er dann nach der Wende als Stipendiat in der römischen Villa Massimo lange und intensiv an einem anderen Stoff, den er dann verwarf. Erst die zeitliche Distanz, das „Abhängen“ des Hiddensee-Themas, ermöglichte ihm die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Vorstellungen von Utopien und Freiheitsvisionen.
Diese Geschichte der Freundschaft von Edgar und Kruso ist als Initiationsgeschichte auch eine Robinsonade: Edgar/Freitag kommt als unbedarfter Neuling auf die Insel, sucht eine Bleibe, findet einen Gelegenheitsjob und wird vom erfahrenen Kruso/Robinson protegiert und in die Gewohnheiten und Rituale der Grenzgänger am Rande der DDR eingewiesen. Edgar studiert Germanistik in Halle, hat sich aber vorübergehend ausgeklinkt, um den Unfalltod seiner Freundin zu bewältigen, die von einer Straßenbahn überfahren wurde. Die Lektüre von Trakl-Gedichten war für ihn ein Erweckungserlebnis: Der düstere „Herbst des Einsamen“ zieht sich für ihn nun durch alle Jahreszeiten: „O! Stille gelb und roter Blumen“. Auch der Trakl-affine Krusowitsch hat eine lyrische Ader, er fabriziert eigene Texte und erkennt im gestrandeten Neuling Edgar den Bruder im Geiste.
Als Mentor, Gruppenmotivator, guter Geist des kuriosen Häufleins von „Schiffbrüchigen“ hat Kruso eine ins Esoterische driftende Schar um sich versammelt, der er Quartiere zuweist und mit eigenartigen Ritualen ein Gefühl der Geborgenheit vermitteln will. Die Suchenden, die sich auf der Insel neu orientieren wollen, will Kruso mit rituellen Waschungen, nächtlichen Treffen am Strand und mit einer „heiligen“ Suppe zu einer Solidargemeinschaft zusammenschweißen. Ganz allmählich gewinnt sein tragischer biografischer Hintergrund präzisere Konturen. Alexander Krusowitsch stammt aus einer russischen Generalsfamilie, die Mutter war Zirkusartistin und starb bei einem Unfall, seine Schwester Sonja (so hieß auch Trakls früh verstorbene Schwester) kam wohl bei einem Fluchtversuch ums Leben. Sie wollte von der Insel nach Dänemark schwimmen, ihr Leichnam wurde aber nie gefunden oder identifiziert.
So ist auch Kruso zum ewig Suchenden geworden: Wo ist Sonja untergegangen? Könnte sie nicht jeden Augenblick wieder auftauchen? Und wie kann man verhindern, dass immer wieder weitere Unbedarfte den Versuch unternehmen, über die Ostsee aus der DDR zu flüchten und dabei ihr Leben lassen? Das treibt ihn um, führt aber auch zu irrationalen, extrem emotionalen Aktionen und Konflikten. Ed ist ja nicht nur von der schweren, stundenlangen Arbeit im Klausner völlig erschöpft, auch der üppige Konsum von Exlepäng, Kiwi (Kirsch-Whisky) und anderen hochprozentigen Mixturen treibt ihn in einen benebelt-entrückten Rauschzustand, den der suchtkranke Trakl (1887–November 1914) und dessen drogensüchtige Schwester Sonja in ähnlicher Form wohl auch mit Morphium und Opium erreichten.
Kruso und Ed ritzen sich mit einer Klinge die Haut auf und schließen Blutsbrüderschaft, bald gibt es aber auch eine wüste Schlägerei – warum, weiß Edgar nicht. Ed wird auch nach einem Gelage von einem anderen Schiffbrüchigen brutal verprügelt und in den Hafen gestoßen, was er gar nicht mehr richtig wahrnehmen kann.
Trotzdem verkündet Kruso seine verquaste Brüder-zur Insel-zur-Freiheit-Philosophie: Das enge Inselbiotop hält er nämlich für die ideale Voraussetzung, um den neuen, freien Menschen zu kultivieren. Denn „der große Inselblick“ würde zurückführen zu den verschütteten Wurzeln: „Gelingt es uns, die Wurzel zu berühren, spüren wir es: Die Freiheit ist da, tief in uns, sie wohnt dort, so tief wie unser innerstes Ich. Das ist die Freiheit, die ich meine.“
Auch Rimbaud lässt grüßen: nicht nur mit blumig-bunten Lautmalereien, auch mit synkretistisch anmutenden Bildern wie etwa den murmelnden Lyrismen, die aus dem Abwaschbecken ertönen, wenn Edgar kräftig in der dreckigen Fettbrühe rührt, die er von Tellern, Gläsern und Pfannen herunterschrubbt.
Mit rationalen Diskursen oder Argumenten wird hier kaum etwas erklärt, es scheint so, als sollten impressionistische Stimmungsbilder ausreichen, um merkwürdige spontan intuitive Verhaltensweisen zu vermitteln. Die aufgestauten Emotionen explodieren, die schwarze Nacht wirkt deprimierend, oder, um es mit Trakl zu formulieren: „blaue Blume tönt leise in vergilbtem Gestein, Sonjas Leben, blaue Stille, wilder Vögel Wanderfahrten, kahler Baum in Herbst und Stille- Sonjas Schritt und sanfte Stille … am Abend regt auf Inseln sich Geflüster“ … Solche Versatzstücke und Gedichtpassagen hat Ed abgespeichert, sie gehen ihm oft durch den Kopf und wirken wie sedierende, trostspendende Schlaftabletten. Dazu passt auch, dass der introvertierte Edgar sich einen in einer Höhle gefundenen toten Fuchs als Gesprächspartner aussucht, dem er sich anvertraut und ihn in kniffligen Situationen um Rat fragt. Leichte Strandlektüre bietet „Kruso“ wahrlich nicht.
„Kruso“ ist kein klassischer Wenderoman, auch kein Aufguss eines Thrillers aus dem Kalten Krieg. Der aufs Tiefschürfen und auf die Konstruktion facettenreicher Psychogramme fixierte Seiler – er war ja vor seinem Studium Baufacharbeiter mit Fächern wie Statik und Werkstoffkunde- liefert stattdessen eine mit lyrischer Intensität fabrizierte introspektive Analyse von Außenseitern, die zwischen enormer Freiheitssehnsucht und gruppensolidarischer Nestwärme zerrissen werden. Am äußersten Inselvorposten der DDR werden sie zwar von Vopos auf Patrouillenbooten beobachtet; auch Wachen kontrollieren die suspekte Kruso-Gruppe. Doch die exotische Künstler- und Intellektuellenkolonie, die sich irgendwo zwischen Woodstock und Bhagvans Meditationszirkus angesiedelt hat, kann immer noch genügend Freiräume auskosten und sich ziemlich unbehelligt auf der Insel entfalten.
Lutz Seiler hatte in seinen ersten Gedichten („fehlerlatein“, 2010) noch das Terrain des thüringischen Uranbergbaus sondiert. Auf den ersten Seiten von „Kruso“ spürt man schnell, dass Seiler sich weniger für die genaue Beschreibung eines realistisch abgebildeten Mikrokosmos interessiert, als für eine Metaebene, die Stimmungen, Sehnsüchte und Psychogramme mit einer geradezu expressionistischen Intensität skizziert. Vor allem will er den mentalen Zustand und die Entwicklung jener Außenseiter unter die Lupe nehmen, die sich in der DDR selbst ausgrenzten, ohne jedoch eine reale Grenze zu überqueren. Und dazu gehörte der beeindruckende Autor Lutz Seiler ja schließlich selbst. Er beschreibt einerseits, ähnlich wie weiland Levi-Strauss in seinen „Traurige Tropen“- Impressionen aus dem brasilianischen Busch, das exotische Treiben eines merkwürdigen exotischen Grüppchens im entlegenen Randgebiet. Er sieht den vom „Gruppenführer“ Kruso inspirierten Ausnahmezustand aber auch als symptomatisch für eine aus den Fugen geratene Epoche, die im totalen Umbruch begriffen war und desorientiert im Nebel diffuser Freiheits-Visionen stocherte. Keine leichte Lektüre, streckenweise auch ziemlich irritierend und verstörend. Aber letztlich doch brillant und überzeugend, weil Lutz Seiler den „Kruso“ mit einer atemberaubenden, tiefen Ernsthaftigkeit und großer Fabulierfreude geschrieben hat.
Peter Münder
Lutz Seiler: Kruso. Suhrkamp 2014. 480 Seiten. 22,95 Euro. Verlagsinformationen zu Buch und Autor.











