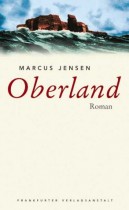Als Schelmenroman bezeichnet der Klappentext das neue Opus von Marcus Jensen und diese Einstufung ist ebenso passend wie völlig unzureichend.
Jensens Erstling Red Rain aus dem Jahr 1999 konnte bereits begeistern als wortgewaltiger literarischer Amoklauf zur damals anstehenden Jahrtausendwende-Hysterie. Was er uns aber nun mit Oberland präsentiert, sprengt alle Erwartungen – und zum Teil auch Lesegewohnheiten. Zehn Jahre hat der 1967 geborene Autor an diesem Mammutwerk gebastelt und gefeilt, herausgekommen ist ein prächtiges Tryptichon über Leben und Tod ebenso wie eine Reise in die deutsche Befindlichkeit (und Untiefen des Musikgeschmacks) der 70er, 80er und 90er Jahre.
Furioser Einstieg
Furios der Einstieg, die Schilderung einer stürmischen Überfahrt nach Helgoland. Inmitten der grünen Elendsgesichter und Würgelaute ein quirliger Junge. Es ist Oktober 1973 und der fünfjährige Jens Behse ist gerade eingeschult worden. Wir befinden uns in der Kindheit des Ich-Erzählers, doch Jensen bricht mit der Erzählperspektive jegliche Konvention. Er schildert Jens’ Erlebnisse weder aus kindlicher Sicht noch zurückblickend aus älterer Perspektive. Vielmehr blickt Jens Behse von „oben“ auf die Szenerie: Er ist tot. In Anlehnung an Berichte von Nahtoderlebnissen, in denen sich die klinisch toten Patienten über dem eigenen Körper wähnen, blickt auch Behse auf sein „ich“. Wie vor einem Fernseher, dessen Fernbedienung jemand anderes bedient, zappt er unvorbereitet in die Szenerie hinein. Er sucht nach Orientierungspunkten, Kalendern oder Zeitungsartikeln, die ihm verraten, in welche Zeit er gerade blickt: „Kann ich lesen oder nicht? Jede Wette, ich bin gerade eingeschult, das hier spielt 1973, und ich weiß zumindest, welche Buchstaben das sind.“
Natürlich hat es „tote“ Erzähler in der Literatur schon gegeben, doch diese Form des Rücksprungs ins eigene Leben dürfte ohnegleichen sein. Der Erzähler in Oberland ist zum Einen natürlich vertraut mit allem, was er nun beobachtet, hat aber andererseits keinen Einfluss darauf, in welche Stationen seines früheren Lebens er „zugeschaltet“ wird. In jedem neuen Abschnitt sucht er so nach Anhaltspunkten für Ort und Zeit – ein raffinierter Kniff Jensens, um gleichermaßen unaufdringlich wie detailversessen Beschreibungen von Mode, Mobiliar und Musik einflechten zu können.
Als Jens beinahe unbeabsichtigt sein Leben durch Leichtsinn auf dem umstürmten Oberdeck verliert (und somit den vorgesehenen Ablauf des Rückblickes gefährdet), greifen vier rätselhafte Gestalten in sein Schicksal ein: Ein vogelhaftes Zwillingspärchen, eine Frau, die der von der Mutter verehrten Sängerin Alexandra zum Verwechseln ähnelt, und ein wikingerähnlicher Bartträger. Der tote Behse erkennt, dass es sich um Geisterwesen handelt, die ihm auch später im Leben wieder begegnen werden (die Zwillinge gar als Papageienpärchen), doch für den kleinen Jens und seine Eltern handelt es sich lediglich um eine illustre Reisegruppe, mit der schnell Freundschaft geschlossen wird. Unterkunft findet die Familie in der Pension von Frau Kerber – von der der tote Erzähler bereits weiß, dass er sie Jahre später als Zivildienstleistender betreuen wird. Viele Fäden werden hier auf dem rauen Oberland der Nordseeinsel aufgenommen, die sich im Verlauf des Romans zu einem feinen Flechtwerk verknüpfen werden. Jens erkennt auf einem Foto den verstorbenen Sohn Frau Kerbers wieder, der ihm bereits auf der Fähre begegnet ist. Der fünfjährige hat nun Angst, selbst bereits tot zu sein. Die unbeholfenen Tröstungsversuche des Vaters, der als engagierter Linker auf alle Fragen zum Thema Sexualität besser vorbereitet wäre, vermögen ihn nicht zu trösten. Erst als die Wirtin ihm erklärt, dass auch sie nicht wisse, was nach dem Tod passiere, beruhigt sich der Junge und schläft ein.
Zeitsprünge
Im 300 Seiten umfassenden Mittelteil des Romans ist Behse 14 Jahr alt, ein unbeholfener Schlacks von 1,91 m, ein Außenseiter, der vom Tod fasziniert ist. Für seine Mitschüler ist er allenfalls geeignet, als Übermittler von Liebesbotschaften zu fungieren. Doch seine Position ändert sich, als die dominante, stark übergewichtige Steff die schützende Hand über ihn hält. Steff ist bereits zweimal sitzen geblieben und scheint für die Klassenkameraden über allem zu stehen. Nicht zuletzt die Tatsache, dass sie sich in Hamburg von alten Männern aushalten lässt, verleiht ihr eine Aura des Verruchten. Abgeklärt weiht sie so manchen Jungen der Klasse in die ernüchternden Geheimnisse der Sexualität ein. Jens wird zum Protokollanten ihres Handelns, er selbst ist erschreckend uninteressiert an Sex und so scheint nur er für die Verletzlichkeit hinter der rauen Schale Steffs empfänglich zu sein.
Im Verlauf dieses zweiten Romanabschnittes erfährt Behses Position innerhalb der Klasse eine gewaltige Wendung. Mit seiner Todessehnsucht, dem festen Glauben, mit seinem toten Geist in Kontakt treten zu können (der wiederum das Handeln des lebenden Behse nicht ohne Ironie schildert), schart Jens ein Grüppchen Anhänger um sich, das Seancen durchführt. Die minutiöse Vorbereitung seines Selbstmordes erfährt ein jähes Ende, als Mitschüler mit bösen Sticheleien die verletzliche Stelle in Steffs Seele treffen und diese Jens mit dem Sprung vom Balkon zuvorkommt. Jens zweckentfremdet daraufhin das Grab, das er für sich ausgehoben hatte, für eine blutige Rache.
Der dritte Zeitsprung führt uns ins Jahr 1989, Behses Zeit als Zivildienstleistender neigt sich dem Ende zu. Doch es ist nicht nur dieser Umstand, der ihn mit einer Leck-mich-am-Arsch-Haltung durch den Klinikalltag rüpeln lässt („Sooo Mädels, wer hat geklingelt?“, „Herbst (des Lebens)? Für Sie ist praktisch Silvester.“), es ist vielmehr das sichere Wissen, dass er sich in Kürze selbst töten wird. Außerdem spürt Jens die Anwesenheit seines toten Ich, beginnt, seinen Geist gezielt anzusprechen. Der erzählende Geist und der Leser haben ihm allerdings etwas Entscheidendes voraus: Sie erkennen in Oma Kerber die Pensionswirtin von Helgoland wieder. Und so fügt sich aus den Andeutungen um eine Inzestgeschichte von der Küste und einer geheimnisvollen Tochter für den Leser ein Gesamtbild, bevor Behse die Zusammenhänge erkennen kann. Die Schnitte werden schneller, Behse inszeniert seinen Selbstmord wie ein spektakuläres Happening vor großem Publikum.
Filigranes Triptychon
Mit Oberland hat Marcus Jensen einen gewaltigen Schritt getan. Die vertrackte Konstruktion und die ungewöhnliche Erzählperspektive stellen für den Leser durchaus eine Herausforderung dar, man muss sich einlassen auf die Ausgangssituation, ob man nun den esoterischen Unterbau belächelt oder nicht. Belohnt wird man mit einem Roman, der Jensens furioses Debüt Red Rain noch toppen kann. Und jeder Flügel dieses filigranen Triptychons weiß das Auge des Betrachters mit einem anderen Pinselstrich in den Bann zu ziehen.
Mit atmosphärischer Dichte, einer zwielichtigen Düsternis und einem mitreißenden Wellengang reißt der erste Teil den Leser schwindelerregend in den Roman hinein. Der raumgreifende Mittelteil ist viel stärker satirisch geprägt. Eine Pubertät in den achtziger Jahren mit ihren Musik- und Modeerscheinungen wird gleichsam zu einer Abrechnung mit der Generation der Eltern und Lehrer. Manchmal trägt Jensen hier ein wenig zu dick auf, wenn er die Dialoge der „gut-dass-wir-mal-drüber-geredet-haben“-Phrasendrescher präsentiert. Hier wirken der Vater und seine altlinken Freunde ein wenig überzeichnet, was aber durch das Bild der arglos Alexandra-Lieder vor sich herträllernden Mutter wieder mehr als aufgewogen wird. Zwischen Fetenkeller-Gesprächsfetzen und todessehnsüchtiger Seance dröhnt Ideals „Eiszeit“ aus den Zeilen, fährt Markus’ Maserati zweihundertzehn und Joachim Witt spielt sich bedrohlich als Herbergsvater auf.
Dennoch will sich dieser Roman nicht in die zur Zeit angesagten 80er-Aufarbeitungsromane einreihen, hebt sich wohltuend ab von folkloristischem Generation Golf-Gehabe. Hier sitzt jeder Satz, jeder Querverweis, hier findet der aufmerksame Leser gar versteckte Verknüpfungen zu Jensens erstem Roman: Da steht Jens Behse zum Beispiel vor dem Badezimmerspiegel und malt sich mit Creme Striche ins Gesicht, als die Tür aufspringt. Der Eindringling reagiert, indem er „Häähähäh – Winnetou“ sagt. In Red Rain wiederum hat ein Junge, der Jens Behse sehr ähnelt, einen Gastauftritt auf einer öffentlichen Toilette, wo er auf den als Indianer verkleideten Erzähler trifft und ebenfalls „Winnetou“ ausruft. Solche Spielereien, häufig aber subtiler und verschlüsselter, finden sich zahlreich in Oberland – man muss sie aber nicht aufspüren, um den Roman genießen zu können. Wer Red Rain nicht kennt, kann sich auch an den wiederkehrenden Motiven innerhalb Oberlands erfreuen. Der Kreislauf der Kapitänsmütze etwa, den Jensen auf geniale Weise rund bekommt, das Motiv des kopflosen Piraten Störtebeker, das schlussendlich gar Behses Selbstmord bestimmt.
Im dritten und abschließenden Teil des Romans erinnern der zynische Tonfall und die raschen Schnitte am stärksten an das Debüt. Auf der Krebsstation des Krankenhauses ist Jens dem Tod bereits besonders nahe, sein Humor ist bösartig und entlarvt Floskeln der Ärzte ebenso wie der Angehörigen.
Aus dem Meer deutschsprachiger Neuerscheinungen ragt dieser mutige Roman so imposant hervor wie der „Lange Anna“ genannte Buntsandstein-Felsturm an Helgolands Küste. Nur eines nehme ich Marcus Jensen übel: dass ich mich während der Lektüre dabei ertappen musste, dass ich Alexandras „Zigeunerjunge“ vor mich hinsummte…
Frank Schorneck
Marcus Jensen: Oberland. Frankfurter Verlagsanstalt 2004. Gebunden. 512 Seiten. 24,90 Euro. ISBN: 3-627-00104-4.