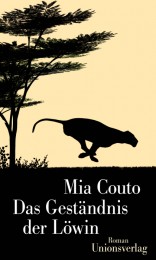 Menschenfressende Löwen
Menschenfressende Löwen
Wenn man nach seinem Lieblingsbuch von Mia Couto gefragt wird, tut einem die Wahl wirklich weh. Der Mosambikaner (*1955, Beira) schreibt seit drei Jahrzehnten literarische Werke verschiedener Gattungen auf gleichbleibend hohem Niveau bei offenbar unerschöpflicher Kreativität. Doris Wieser hat alle gelesen.
Der soeben erschienene Roman „Das Geständnis der Löwin“ steht in Sachen poetischer Dichte, sprachlicher Knappheit bei gleichzeitiger inhaltlicher Komplexität und psychologischer wie kultureller Tiefe den Vorgängerwerken in nichts nach. Als weißer Sohn portugiesischer Siedler und seit der Unabhängigkeitserklärung von 1975 mosambikanischer Staatsbürger verfügt Mia Couto über eine privilegierte Doppelperspektive, die sich besonders dafür eignet, uns hierzulande die Realitäten des südostafrikanischen Landes zugänglich zu machen. Von seinen Eltern bekam er die portugiesische Kultur vermittelt, das Umfeld vermittelte ihm die mosambikanische. Mit großer Sensibilität fühlt er sich in Figuren unterschiedlicher Hautfarbe und sozialer Schicht und die dadurch bedingten unterschiedlichen Erfahrungswelten in kolonialer sowie postkolonialer Zeit ein. Er übernimmt dadurch eine wichtige „Arbeit“ in Hinblick auf das kulturelle Gedächtnis der jungen Nation. War in den Jahren nach der Unabhängigkeit der Journalismus seine erste Schreibschule, so gewinnt der Biologe (er arbeitet im Bereich Umweltforschung und Umweltschutz sowie als Dozent an der Universität) heute den Stoff für seine Geschichten aus den unzähligen Begegnungen mit Menschen während seiner Exkursionen.

Mia Couto (Foto: Alfredo Cunha/Unionsverlag)
Das Geständnis der Löwin
„Das Geständnis der Löwin“ erzählt in alternierenden Kapiteln mit unterschiedlichen Ich-Erzählern zwei miteinander verknüpfte Geschichten: die Mariamars und die des Jägers Arcanjo Baleiro. Mariamar lebt in einem abgelegenen Dorf namens Kulumani im Norden Mosambiks als Tochter von Assimilierten, das heißt von Schwarzen, die während der Kolonialzeit ihrer ursprünglichen Kultur abgeschworen und die portugiesische Kultur sowie die dadurch implizierten Privilegien offiziell angenommen haben. Deswegen gehört Mariamar im postkolonialen Mosambik nie ganz zur Gemeinschaft (beispielsweise, weil ihre Mutter das Initiationsritual nicht durchlaufen hat). Als hungrige Löwen beginnen, die Frauen des Dorfes zu töten, fordert der Distriktverwalter Hilfe aus Maputo an. Zur Jagd der Löwen reist der Mulatte Arcanjo Baleiro an, dessen Tagebuch wir zu lesen bekommen. Aus dem Prolog erfahren wir, dass sich Mia Couto hierbei an einer wahren Begebenheit inspiriert hat. 2008 wurden 26 Menschen in Vila de Palma (Cabo Delgado) von Löwen getötet. Jäger konnten die Tiere erlegen, die Bevölkerung schob die Ereignisse jedoch Geistern zu.
Durch dieses Setting werden von Beginn an widerstreitende Kräfte einander gegenübergestellt: Frau und Mann, Land und Stadt, Natur und Kultur, Tier und Mensch, Tradition und Modernität. Zwischen diesen Antipoden zerreiben sich die Figuren in einem andauernden Ringen um ein unerreichbares bisschen Glück.
»Nun geriete wie nach jedem Krieg alles in Unordnung: Die Menschen würden zu Tieren und die Tiere zu Menschen.« (113).
Sowohl im vor Kurzem bei Wunderhorn erschienenen „Jesusalem“ (zur Rezension bei LitMag) als auch in „Das Geständnis der Löwin“ liegen die Schlüssel für das Verstehen des komplizierten Beziehungsgeflechts zwischen den Dorfbewohnern, insbesondere zwischen Mariamar und ihrem Vater, ihrer Mutter und ihren verstorbenen Zwillingsschwestern, in der Vergangenheit so lange begraben, bis der Lebenswille die Siegel des Schweigens zerschlägt. So ist der Text voller spannungsgenerierenden Leerstellen, die erst spät gefüllt werden. Leerstellen des Schmerzes, des Unaussprechlichen, des Schweigens aufgrund von Traumata und Angst. Die einzelnen Vorkommnisse muten geradezu antik, biblisch oder gar archaisch an: ein Vater, der seine Tochter vergewaltigt und schwängert; eine Mutter, die die Schuld dafür auf die Tochter schiebt; eine den wilden Löwen zugeschriebene Massenvergewaltigung mit Selbstmordfolge beim Opfer, Todessehnsucht aus unerfüllter Liebe, Verfall in Wahnsinn nach einem begangenen Mord.
 „Das Geständnis der Löwin“ ist ein geradezu allegorischer Text, bei dem eine Gruppe Löwen zugleich das Tierische im Menschen und das Menschliche im Tier verkörpert. Doch die Bedeutung der Löwen changiert unablässig. So werden sie beispielsweise auch mit dem kolonialen Heer verglichen: „Die Löwen haben mich an die Soldaten der portugiesischen Armee erinnert. Wir haben uns die Portugiesen so lange in unserer Fantasie vorgestellt, bis sie mächtig geworden sind. Die Portugiesen waren nicht stark genug, uns zu besiegen. Deshalb haben sie dafür gesorgt, dass ihre Opfer sich gegenseitig umbringen. Und wir, die Schwarzen, haben gelernt, uns selbst zu hassen“ (113). Die Löwen stehen somit insgesamt für einen Zustand, in dem der Mensch die Kontrolle über die Natur und über sich selbst als Folge des Krieges verloren hat.
„Das Geständnis der Löwin“ ist ein geradezu allegorischer Text, bei dem eine Gruppe Löwen zugleich das Tierische im Menschen und das Menschliche im Tier verkörpert. Doch die Bedeutung der Löwen changiert unablässig. So werden sie beispielsweise auch mit dem kolonialen Heer verglichen: „Die Löwen haben mich an die Soldaten der portugiesischen Armee erinnert. Wir haben uns die Portugiesen so lange in unserer Fantasie vorgestellt, bis sie mächtig geworden sind. Die Portugiesen waren nicht stark genug, uns zu besiegen. Deshalb haben sie dafür gesorgt, dass ihre Opfer sich gegenseitig umbringen. Und wir, die Schwarzen, haben gelernt, uns selbst zu hassen“ (113). Die Löwen stehen somit insgesamt für einen Zustand, in dem der Mensch die Kontrolle über die Natur und über sich selbst als Folge des Krieges verloren hat.
»Uns Frauen, uns hat man schon vor langer Zeit begraben. Dein Vatter hat mich begraben; deine Großmutter, deine Urgroßmutter, sie alle wurden zu Lebzeiten begraben« (45).
All diese im Grunde universellen Themen der Menschheit, stellt Mia Couto unverkennbar in einen mosambikanischen Kontext, in dem jede Handlung eine kulturelle Bedeutung erhält:
Dem matriarchalischen oder vorsichtiger ausgedrückt mutterrechtlich organisierten Norden des Landes, in dessen Mythen Gott eine Frau ist, wird ein friedlicheres Zusammenleben der Familien nachgesagt. Dass diese Unterscheidung in Nord-Süd nicht unbedingt weit trägt, erklärt Mia Couto in einem Interview. Auch in den nördlichen Kulturen der Maconde und Macua, leiden Frauen an Unfreiheit und Gewalt, wobei häufig der Onkel mütterlicherseits sowie der Ältestenrat das Patriarchat entgegen der landläufigen Vorstellung hinter dem Rücken der Frauen durchsetzen. So dürfen Frauen Männern beim Gespräch nicht in die Augen schauen, bestimmte Orte wie das Terrain der Initiationsriten nicht betreten oder werden gar „zugenäht“, damit sie während der Abwesenheit des Mannes, nicht fremdgehen können.
»Eine unfruchtbare Frau ist in Kulumani weniger wert als eine Sache. Sie existiert einfach nicht.« (125)
Das Wüten der titelgebenden Löwin, die sich gegenüber ihren männlichen Artgenossen tatsächlich als die Stärkere erweist, meint im übertragenen Sinn die Rebellion der Frauen gegen die Männer. Ein notwendiges Aufbegehren, das jedoch zu keinem befriedigenden Ergebnis führt, denn selbst die erlegten Tiere werden noch geschlechterspezifisch diskriminiert: In die Zeitung kommen nur die Fotos der angeblich beeindruckenderen männlichen Tiere. Daran ändert auch Naftalindas todesmutiger Kampf um die Aufklärung der Massenvergewaltigung und um die Rückgewinnung der Liebe ihres Mannes, des ehrgeizigen Distriktverwalters Florindo Makwala, in letzter Konsequenz nichts.
Trotz aller kultureller Fremdartigkeit geht es in „Das Geständnis der Löwin“ um vertraute Themen, die von der Universalität des menschlichen Fühlens und Erlebens zeugen: Liebe, Eifersucht, die vielfältigen Schwierigkeiten des Zusammenlebens. Ein besonderes Qualitätsmerkmal des Romans ist dabei nicht nur seine bildliche Dichte sondern auch seine Bedeutungsoffenheit und Vielschichtigkeit.
Das schlafwandelnde Land
Wer der bestechenden Schönheit von Mia Coutos Prosa erlegen ist, darf sich besonders freuen, dass der Unionsverlag neben „Das Geständnis der Löwin“ soeben ein älteres seiner Werke neu aufgelegt hat: „Das schlafwandelnde Land“ ist der Roman, der Mia Couto weit über die Landesgrenzen hinweg berühmt gemacht hat. Er wurde nicht nur 2007 von Teresa Prata verfilmt, sondern auch in Maputo im von Henning Mankell geleiteten Teatro Avenida von der Theatergruppe Luarte inszeniert und im Sommer 2011 aufgeführt.
Der Roman erzählt ein Bündel von Geschichten, deren Schnittstelle der vom Bürgerkrieg traumatisierte und seines Gedächtnisses beraubte Junge Muidinga ist. Gemeinsam mit dem alten Tuahir und den Aufzeichnungen des Kindzu, die er in einem ausgebrannten Bus findet, beschreitet er eine Reise auf der Suche nach seiner Vergangenheit…
Doris Wieser
Foto Alfredo Cunha
Mia Couto: Das Geständnis der Löwin (A confissão da leoa 2012). Aus dem Portugiesischen von Karin von Schweder-Schreiner. Unionsverlag 2014. 272 Seiten 19,95 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Mehr zum Autor.
Mia Couto: Das schlafwandelnde Land (Terra sonâmbula 1992). Aus dem Portugiesischen von Karin von Schweder-Schreiner. Unionsverlag 2014. 230 Seiten. 11,95 Euro. (Deutsche Erstausgabe: dipa Verlag 1994). Verlagsinformationen zum Buch.
Mehr über Doris Wieser.












