 Joachim Feldmann
Joachim Feldmann
– Der Muret-Sanders (5. Auflage 1978), auch als Langenscheidts Enzyklopädisches Wörterbuch der englischen und deutschen Sprache bekannt, schlägt für das Adjektiv „blithe“ folgende Bedeutungen vor: fröhlich, lustig, munter, vergnügt. Als veraltet werden hingegen die Übersetzungen „gütig“ und „freundlich“ markiert. Beide Bezeichnungen wären auch denkbar ungeeignet, um Frederic J. Frenger jun. zu charakterisieren. Denn der 28-jährige Gewohnheitsverbrecher aus Kalifornien hat während der langen Zeit, die er in staatlichen Institutionen verbringen durfte, eins gelernt: Altruismus führt zu nichts. Oder um es in den Worten Charles Willefords, der mit Frenger einen der bemerkenswertesten Schurken der Kriminalliteratur erfunden hat, auszudrücken:
„Sein Wunsch, anderen Gutes zu tun, war die Wurzel seiner Probleme gewesen und hatte sein Leben schlimmer statt angenehmer gemacht“.
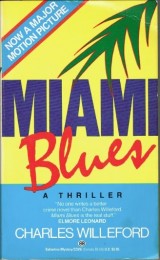 Das Zitat stammt aus der überarbeiteten deutschen Fassung von Willefords „Miami Blues“, die dieser Tage im Alexander Verlag erschienen ist. In der ursprünglichen Übersetzung (Ullstein 1987) war noch von einem „Herzensanliegen“ und dem „Wohlergehen anderer“ die Rede gewesen, während es im Original schlicht heißt: „His desire for the good of others had been at the root of his problem, making his own life worse instead of better.“ Offenbar war es Rainer Schmidt, der für die Ullstein-Version verantwortlich ist, ein Herzensanliegen gewesen, durch eine gelegentlich altfränkisch anmutende Wortwahl die böse Ironie des Originals noch zu steigern.
Das Zitat stammt aus der überarbeiteten deutschen Fassung von Willefords „Miami Blues“, die dieser Tage im Alexander Verlag erschienen ist. In der ursprünglichen Übersetzung (Ullstein 1987) war noch von einem „Herzensanliegen“ und dem „Wohlergehen anderer“ die Rede gewesen, während es im Original schlicht heißt: „His desire for the good of others had been at the root of his problem, making his own life worse instead of better.“ Offenbar war es Rainer Schmidt, der für die Ullstein-Version verantwortlich ist, ein Herzensanliegen gewesen, durch eine gelegentlich altfränkisch anmutende Wortwahl die böse Ironie des Originals noch zu steigern.
Und so kam es vielleicht auch zu jenem Satz, den wohl niemand, dem vor 28 Jahren das gelbe Taschenbuch mit dem hässlichen Cover in die Hände fiel, vergessen wird: „Frederic J. Frenger, Jr., ein wohlgemuter Psychopath aus Kalifornien, bat die Stewardeß in der ersten Klasse um ein weiteres Glas Champagner und Schreibzeug.“ Also nicht „vergnügt“ oder gar „lustig“. Das passte. Auch gegen das Attribut „unbekümmert“, für das sich Jochen Stremmel, der für die Bearbeitung der alten Übersetzung verantwortlich zeichnet, entschieden hat, ist wenig einzuwenden. Denn was sollte Frenger, einem hochintelligenten, durchtrainierten Individuum, das zudem im Besitz von vier geraubten Kreditkarten ist, auch Kummer bereiten? Dass die Welt schlecht und Undank der Mühe Lohn ist, hat man ihm auf schmerzhafte Weise im Knast beigebracht. Diese Erfahrung hat er den sträflich naiven Helden der europäischen Literatur des 18. Jahrhunderts wie Voltaires „Candide“ (1759) oder Johann Carl Wezels „Belphegor“ (1776), denen es oblag, in satirischer Manier den Beweis zu führen, dass wir mitnichten in der besten aller möglichen Welten leben, voraus.
Essigkuchen
 Außerdem ist Frederic J. Frenger jun. Amerikaner und als solcher fest entschlossen, zumindest seine Welt so zu gestalten, wie sie ihm gefällt. Mittel zum Zweck ist ihm dabei ausgerechnet die zwanzigjährige Susan Waggoner, eine Prostituierte mit kindlichem Gemüt und gruseliger Biografie. Charles Willeford gestaltet die Beziehung der beiden als grausame Travestie kleinbürgerlicher Idylle. Und dass sie ausgerechnet Hoke Moseley über den Weg laufen müssen, einem der bemitleidenswertesten Ermittler der Kriminalliteratur, treibt die perfide Ironie des Romans auf die Spitze. Dem Polizisten nämlich, der getrennt von seiner Familie in einem heruntergekommenen Hotel haust, kommt im Verlauf seiner Ermittlungen nicht nur zweimal ein künstliches Gebiss abhanden (Traumdeuter aufgepasst!), sondern auch Marke und Dienstwaffe. Wer diese Insignien der staatlichen Gewalt nun zu ganz eigenen Zwecken benutzt, lässt sich leicht erraten.
Außerdem ist Frederic J. Frenger jun. Amerikaner und als solcher fest entschlossen, zumindest seine Welt so zu gestalten, wie sie ihm gefällt. Mittel zum Zweck ist ihm dabei ausgerechnet die zwanzigjährige Susan Waggoner, eine Prostituierte mit kindlichem Gemüt und gruseliger Biografie. Charles Willeford gestaltet die Beziehung der beiden als grausame Travestie kleinbürgerlicher Idylle. Und dass sie ausgerechnet Hoke Moseley über den Weg laufen müssen, einem der bemitleidenswertesten Ermittler der Kriminalliteratur, treibt die perfide Ironie des Romans auf die Spitze. Dem Polizisten nämlich, der getrennt von seiner Familie in einem heruntergekommenen Hotel haust, kommt im Verlauf seiner Ermittlungen nicht nur zweimal ein künstliches Gebiss abhanden (Traumdeuter aufgepasst!), sondern auch Marke und Dienstwaffe. Wer diese Insignien der staatlichen Gewalt nun zu ganz eigenen Zwecken benutzt, lässt sich leicht erraten.
„Miami Blues“ gilt zu Recht als Klassiker seines Genres, da Charles Willeford sich in virtuoser Weise auf dessen Regeln und Klischees einlässt.
„Der Mensch – ist das ärgste Ungeheuer der Hölle. Ich bin mir selbst gram, ein Mensch zu seyn“, lässt der große Pessimist Wezel seinen Belphegor dessen Leidensweg resümieren. Die Überzeugung, dass die Natur „die Menschen recht schlimm werden ließ, um sie leidlich gut werden zu lassen“, mag er allerdings nicht aufgeben. Bei Charles Willeford geht es lakonischer zu. Im Schlusskapitel von „Miami Blues“ findet sich ein Rezept für einen Essigkuchen, der seiner Schöpferin, Mrs. Frank Mansfield, vormals Ms. Susan Waggoner den ersten Preis beim Tri-County-Backwettbewerb in Ocala eingebracht hat. Am Leser ist es zu entscheiden, welches Ende das zynischere ist.
Joachim Feldmann bei Am Erker. Zu den CULTurMAG-Beiträgen von Joachim Feldmann.
Charles Willeford: Miami Blues (Miami Blues, 1984). Der erste Hoke-Moseley-Fall. Roman. Deutsch von Rainer Schmidt. Mit einem Gespräch mit Charles Willeford und John Keasler (dt. von Jochen Stremmel) und einem E-Mail-Wechsel von Jon A. Jackson und Jochen Stremmel. Berlin: Alexander Verlag 2015. 167 Seiten. 14,90 Euro. Verlagsinformationen zu Buch und Autor.











