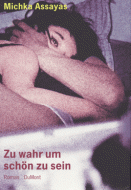 Nicht jeder deprimierte Erzähler ist ein neuer Houellebecq
Nicht jeder deprimierte Erzähler ist ein neuer Houellebecq
Der französische Rockkritiker und Autor Michka Assayas scheitert mit seinem Generationsroman trotz seines Insiderwissens an seinen erzählerischen Fähigkeiten. Von Markus Kuhn
Literatur, in der auf die Jugend in einem vergangenen Jahrzehnt – z.B. in den Achtzigern – zurückgeblickt wird, in der das eigene Schicksal zum Exempel der jeweiligen Generation stilisiert wird, hat in den letzten Jahren einen erstaunlichen Erfolg gehabt (man denke an Thomas Brussigs DDR-Rückblicke oder Sven Regeners Herr-Lehmann-Trilogie). Die besten dieser Romane schaffen es, das Gefühl jener Jahre tatsächlich einzufangen: Man meint die Mode, Filme, Bilder von einst wiederzusehen, meint die Musik zu hören, die Waren in den Einkaufswagen zu schmeißen, die damals so gekauft wurden, die spezifischen Gerüche zu riechen und sich daran zu erinnern, wie es war, als chancenlos verliebter 16-Jähriger seinen Trost in der eigenen Plattensammlung zu suchen – das alles funktioniert, selbst wenn man nicht aus jener Generation oder Stadt stammt, die der Roman beschreibt.
Zu dieser unterhaltsamen und meist aufschlussreichen Gruppe an Jugenderinnerungs- und Generationsromanen zählt Michka Assayas „Zu wahr um schön zu sein“ nicht. Der Roman des 46-jährigen Franzosen erweckt eher den Eindruck, dass sich ein Opfer der Midlife-crisis auf extrem spaßfreie und väterliche Weise an die Illusionen seiner Jugend erinnert. Assayas schmeißt derart mit berühmten Namen, Kultur- und Politikeranekdoten um sich, als lasse sich sein Buch nur durch stammtischwürdiges Namedropping rechtfertigen. Atmosphärisch dichtes Erzählen gelingt ihm dabei kaum.
Jenseits von Spaßgesellschaft und Arbeitswelt
Der gerade erst 40-jährige Protagonist und Erzähler Philippe führt ein deprimierendes Leben. Mit dem kleinen Erbe seiner böhmischen Großmutter schlägt er sich durch einen Alltag, in dem er nichts Bemerkenswertes zu tun hat. Zu seinen Eltern hat er niemals eine stabile Beziehung aufbauen können. Vor einem bürgerlichen Leben mit Frau und Kindern flieht er in sexuelle Perversitäten. Fremd sind ihm die ehemaligen Weggefährten, fremd Spaßgesellschaft und Gegenwart, fremd die gesamte Arbeitswelt.
Der Tod der Mutter eines ehemaligen Schulfreundes löst eine Erinnerungskette aus. Im Hin und Her zwischen verklärter Vergangenheit und sinnloser Gegenwart versucht Philippe sein Leben mit hohem Rechtfertigungsdrang zu rekapitulieren. Die Schuld für sein Versagen sucht er bei anderen: bei seiner Mutter, die sich vor allem für sich und ihre Karriere interessiert hat. Und bei den Achtundsechzigern, deren Scheitern er in den 70er Jahren beobachten musste. Aus der Verweigerungshaltung der Punk- und New-Wave-Bewegung, in die er sich dabei geflüchtet hat, ist er niemals wieder herausgekommen. Nur die Gesellschaft um ihn herum hat sich weiterentwickelt.
All das hätte trotz einiger Schwächen einen guten Roman abgeben können, wäre „Zu wahr um schön zu sein“ nicht in einem kunstlosen, extrem gewöhnlichen Schulaufsatz-Stil geschrieben. Hinzu kommt, dass Assayas eher assoziativ vorgeht. Kaum bekommt ein Handlungsstrang mal eine erzählerische Kontur schweift Assayas ab – am liebsten mit unoriginellen gesellschaftskritischen Abstraktionen. So kann weder eine plotorientierte noch eine stilistische Spannung aufkommen.
Assayas – Darsteller in der Verfilmung von Michel Houellebecqs „Ausweitung der Kampfzone“ – wird oft mit seinem Freund und Schriftstellerkollegen Houellebecq in einem Atemzug genannt. Ein Protagonist, der sexgeil, pervers und depressiv durch trostlose Tage treibt, der am Computer masturbiert, die Neoliberalität des Liebesmarktes anprangert, aber trotzdem von ihr profitiert und die Schuld bei den Achtundsechzigern sucht, das klingt stark nach dem umstrittenen und populären Houellebecq. Doch dem jenseits aller Skandaltöne stilistisch sicheren Houellebecq mit seiner ins Mark gesellschaftlicher Ungeheuerlichkeiten schneidenden Treffsicherheit ist Assayas in keiner Weise gewachsen. Da hilft auch all das Insiderwissen über Pop und Punk nicht, mit dem Assayas als Rockkritiker und Autor des „Dictionnaire du Rock“ seinen Romanversuch überschwemmt.
Markus Kuhn
Michka Assayas: „Zu wahr um schön zu sein“.
Aus dem Französischen von Brigitte Große.
DuMont Verlag, Köln 2004.
Gebunden. 270 Seiten, 21,90 Euro.
06.12.2004











