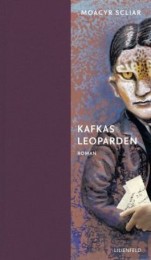 Wie Kafkas Leoparden nach Brasilien kamen.
Wie Kafkas Leoparden nach Brasilien kamen.
Leoparden im Tempel:
Leoparden brechen in den Tempel ein und saufen die Opferkrüge leer; das wiederholt sich immer wieder; schließlich kann man es vorausberechnen, und es wird ein Teil der Zeremonie. Franz Kafka
Diese Kürzestgeschichte oder eher dieser Aphorismus bildet den Dreh- und Angelpunkt der Novelle „Kafkas Leoparden“ des brasilianischen Autors Moacyr Scliar (1937-2011). An ihrer Deutung haben sich die Kafka-Exegeten die Zähne ausgebissen, wie auch an so manch anderem seiner Texte. Als eine „Anfangsgeschichte der Moderne“ liest sie beispielsweise Tobias Döring. Ratinho, der Protagonist aus „Kafkas Leoparden“, will darin eine zweckgebundene, kommunistische Geheimbotschaft entdecken. Er fügt also den unzähligen Deutungsversuchen eine aus der Sicht der Literaturwissenschaft ziemlich abwegige, aber am Text nicht minder belegbare Interpretation hinzu. Die Novelle veranschaulicht auf diese Weise einmal mehr, wie eng jede Auslegung an den Horizont und die konkreten Erwartungen des Betrachters gebunden ist. Gleichzeitig wirft sie implizit die in der Literaturwissenschaft periodisch wiederkehrende Frage auf, ob uns die Intention des Autors zu interessieren hat oder wir den Text unabhängig davon für sich selbst sprechen lassen sollen. Von Doris Wieser
Chiffre oder Allegorie?
In der Forschung bleibt strittig, ob das Werk des Verfassers von „Die Verwandlung“ dechiffriert werden kann. Stellen die Leoparden aus obigem Text eine Allegorie dar? Kann ihr Handeln somit sinnstiftend aufgelöst werden? Oder bleiben die Raubtiere auf immer opak, eine geheimnisvolle Chiffre? Der fiktionalisierte Kafka aus Moacyr Scliars Novelle gibt darauf eine klare Antwort: Es geht ihm um die Rätselhaftigkeit an sich, die ihn vom Zwang des Konkreten befreit. „Rätselhaftigkeit […], manche meinen, das sei das Problem. Für mich ist es die Lösung“ (S. 90), sagt er und entbindet so den verwirrten Ratinho von der Last der „richtigen“ Auslegung im Sinne der Autorintention. Er übergibt gleichsam die Deutungshoheit an den Leser: „Sie müssen die Botschaft daher gar nicht verstehen. Es kommt auf die persönlichen Affinitäten an. Und vielleicht sind diese Affinitäten nicht vorhanden“ (S. 93).
Als Sohn jüdischer Einwanderer aus Bessarabien befasst sich Moacyr Scliar häufig mit jüdischen Figuren, wie auch in „Kafkas Leoparden“. Der größte Teil der Geschichte spielt sich in der bessarabischen Kleinstadt Tschernowitzky (heute Ukraine) sowie in Prag ab und handelt von den Erlebnissen des Benjamin Kantarovitch, genannt Ratinho (Mäuschen), dem Großonkel des Erzählers. 1916 überträgt ihm sein bester Freund Jossi einen wichtigen, politischen Geheimauftrag, den dieser direkt von Trotzki empfangen haben will. Ausführen kann Jossi den Auftrag jedoch nicht mehr, da er im Sterben liegt. Ratinho soll an seiner Stelle nach Prag fahren, dort mit einem gewissen Schriftsteller in Kontakt treten und ihm ausrichten, dass er beauftragt sei, „den Text abzuholen“. Besagter Text ergäbe in der Zusammenschau mit einem weiteren, der sich in Jossis Unterlagen befindet, eine Geheimbotschaft. Moacyr Scliar spielt hier nicht nur mit common places aus Detektiv- und Agentengeschichten seit Poe, sondern auch mit der Vorstellung der literarischen Sprache als Geheimschrift, für deren Entschlüsselung es eines Codes bedarf. Dieser Code kommt dem völlig unerfahrenen und schusseligen Ratinho indes abhanden: Er vergisst die Tasche mit den Unterlagen im Zug; von nun an läuft alles schief.
Zufälle und Missverständnisse
Der unbescholtene Ratinho versucht sich selbst durchzuschlagen und den Auftrag diensteifrig und in Treue seinem Freund ergeben zu erfüllen. Er beginnt sich nach dem Zufallsprinzip durchzufragen, hält schließlich Kafka für seinen Kontaktmann und den Leoparden-Text für eine kommunistische Geheimbotschaft, die ihn glauben macht, ein Juweliergeschäft überfallen zu müssen. Schritt für Schritt fügt sich alles in Ratinhos Erwartungen. Er wähnt sich auf der richtigen Spur. Der Leser ahnt jedoch, dass es sich um eine schier unglaubliche Kette von Missverständnissen handelt. Auch wenn Ratinhos Hypothesen teils zu einfältig wirken und den Leser tendenziell langweilen, machen sie Scliars Geschichte humorvoll, witzig und geben ihr trotz der potenziell ernsten Thematik (ein osteuropäischer Jude führt im Klima der herannahenden bolschewistischen Oktoberrevolution einen trotzkistischen Geheimauftrag in Prag aus) eine genüssliche Leichtigkeit.
Ernst wird der Text erst, als die Geschichte nach Brasilien überschwappt. Sie vollzieht dabei gleichzeitig einen Zeitsprung ins Jahr 1965, also in die Epoche der brasilianischen Militärdiktatur, und berichtet davon, wie Ratinho mithilfe des Leoparden-Textes seinen Neffen Jaime Kantarovitch vor den Häschern des Regimes rettet. Tiefer in die Wirren der historischen Zusammenhänge und ideologischen Beweggründe der Figuren dringt Scliar jedoch nicht ein. Daher schlägt vermutlich mancher Leser das Buch mit dem Gefühl zu, dass der Autor noch mehr aus dem an sich hochinteressanten Material hätte machen können. Scliars Novelle will indes nichts anderes sein als ein Narrativ der kleinen Zufälle mit großer Bedeutung für den Einzelnen, eine Erzählung über den symbolischen Wert von individuellen Erlebnissen und vor allem über die (Un)Möglichkeit eines adäquaten Verstehens von Texten.
Die sehr schöne bibliophile Ausgabe des Lilienfeld Verlags enthält ein informatives, äußerst hilfreiches Nachwort des Übersetzers Michael Kegler, der sich einmal mehr um eine rundum gelungene Übersetzung verdient gemacht hat.
Doris Wieser
Moacyr Scliar: Kafkas Leoparden (Os Leopardos de Kafka, 2000). Aus dem brasilianischen Portugiesisch und mit einem Nachwort von Michael Kegler. Düsseldorf: Lilienfeld Verlag 2013. 135 Seiten. 18,90 Euro. Foto: Wikipedia, Creative Commons 3.0, Quelle: Agência Brasil, Autor: J. Freitas/ABr.












