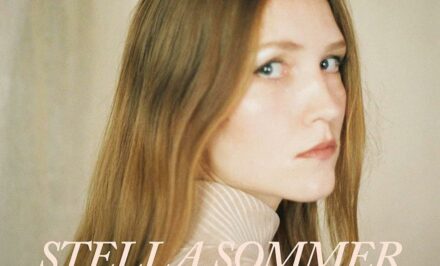Neue Deutsche Welle und Punk – zwei Jugendkulturen, die die Musikgeschichte entscheidend verändert und ganz subjektiv so manche Jugend erst zu dem gemacht haben, was sie war. Christina Mohr hat sich zwei Bücher zu Punk und NDW angesehen.
 Geschichte wird gemacht – und aufgeschrieben
Geschichte wird gemacht – und aufgeschrieben
Mit der Rezeption von Jugendkulturen ist es so eine Sache. Entweder man ist gerade Teil davon, dann hat man weder Lust noch Zeit, um sich analytisch zu äußern, abgesehen davon, dass man nichts weniger tun will, als – gähn – Frühergeborenen zu erklären, warum man diese oder jene Musik mag, eine bestimmte Klamottenmarke bevorzugt und weshalb man in diesem seltsamen Jargon spricht. Oder man war mal Teil einer Jugendbewegung und möchte sich Jahrzehnte später kritisch davon distanzieren. Oder man jubiliert völlig unkritisch über goldene, längst vergangene Zeiten. Oder man war nie Teil irgendeiner Bewegung und schaut mit kühl-sezierendem Insektenforscherblick auf die merkwürdigen Typen und Typinnen, die sich vor Äonen Seifen-Bier-Gemische ins Haar schmierten und Kindersonnenbrillen trugen. Über der historischen Einschätzung von Jugendbewegungen kreist also stets der Geier namens Subjektivität und verdirbt alles. Hierzulande ist es insbesondere die Neue Deutsche Welle, kurz NDW, deren Geschichtsschreibung voll grausamer Fehleinschätzungen, Missverständnisse und Leerstellen steckt. Viele Autoren haben bisher versucht, das kurzlebige Phänomen zu beleuchten, darunter der heutige Vorstandschef der Axel Springer AG Mathias Döpfner, der 1984 als 21-jähriger aufstrebender Journalist mit seinem Kollegen Thomas Garms das Werk „Neue Deutsche Welle. Kunst oder Mode?“ verfasste, oder Hollow Skai, der unlängst mit „Alles nur geträumt?“ seine scharfsinnige, aber höchst subjektive Sicht auf die NDW veröffentlichte. Man selbst (sofern man im „richtigen“ Alter ist, also ca. zwischen 1960 und 1970 zur Welt kam) kann auch nur erratisch zur Aufklärung beitragen, denn man befand sich zur besagten Zeit mitten in der Pubertät oder kurz davor und stand dem Geschehen entweder distanzlos-begeistert oder gleichgültig-unbedarft gegenüber. Die NDW rächt sich für die unzureichende Aufarbeitung mit epidemischen Partys, die sie bevorzugt auf dem Land stattfinden lässt und dort ihre Untoten wie Extrabreit, Markus, Frl. Menke oder Hubert Kah dem Bierzelttreiben preisgibt. Mit Markus, Menke und Kah sind nun endlich ein paar Namen gefallen, die vielen NDW-Partybesuchern als ‚echte‘ NDW-Stars gelten. Doch mit der NDW verhält es sich ähnlich wie mit Punk: je genauer man hinschaut, desto disparater wird das eben noch als einheitlicher Stil betrachtete Ganze, die Welle zerbricht in tausend Einzelströmungen und -tröpfchen und wird ungreifbar. Die NDW war mehr als „Ich will Spaß“, „Da, da, da“ und „Hohe Berge“ – und bestand doch essenziell aus Songs wie diesen. Alfred Hilsberg prägte 1979 den Begriff „Neue Deutsche Welle“ in einem Artikel für die Zeitschrift „Sounds“ – um sich kurze Zeit später angeekelt und vehement gegen Begriff und Musik zu stemmen. Ohne frühe deutsche Punkbands wie Slime und Daily Terror wäre die NDW undenkbar gewesen – aber was haben die Spider Murphy Gang, UKW und Ixi mit Punk zu tun? Wo sind Bands wie Foyer des Arts, Die Doraus und die Marinas, Palais Schaumburg, Der Plan einzuordnen – ist das Kunst oder Punk oder NDW? Was ist von dem seltsamen Heimat-Komplex der NDW zu halten? Ist „Der Mussolini“ von DAF faschistoid? Sind Trio, Ideal und Fehlfarben die eigentlichen, echten NDW-Gruppen? War „Blaue Augen“ von Ideal ein moderner Schlager und wenn ja, warum? Wieso verließ Peter Hein die Fehlfarben direkt nachdem sie das wichtigste deutschsprachige Album aller Zeiten aufgenommen hatten? Und weshalb wurde Nena der größte Star der NDW, obwohl sie und ihre Band überhaupt nichts NDW-typisches an sich hatten?
Eine Million Fragen zu einer so paradoxen wie kurzlebigen Popkultur und – bisher – keine befriedigenden Antworten. Aber jetzt, drei Jahrzehnte nach der Hochphase der NDW kommt Licht ins Dunkel. Die Hildesheimer Kulturwissenschaftlerin Barbara Hornberger legt mit „Geschichte wird gemacht. Die Neue Deutsche Welle. Eine Epoche deutscher Popmusik“ eine innovative und umfassende Betrachtung der NDW vor. Hornberger beschränkt sich nicht auf eine Perspektive, sie untersucht die NDW nach kulturhistorischen, soziologischen, ästhetischen und musikwissenschaftlichen Fragestellungen und erreicht so eine Neubewertung von Musik, Stil und auch der Fans, deren Biographie durch die wissenschaftliche Betrachtung aufgewertet wird, wie Hornberger nicht ohne Selbstironie im Vorwort schreibt. Hornberger bezeichnet die NDW als Jugendbewegung – also über Musik und Mode hinausreichend – weshalb der spartenübergreifende Untersuchungsansatz der einzig richtige ist. Sie setzt Schwerpunkte, was schon das Buchcover unterstreicht: nicht etwa Ideal oder Nena zieren den Einband, sondern die Düsseldorfer Band Mittagspause. Hornberger räumt den scheinbar so typischen NDW-Acts wie Extrabreit oder Hubert Kah wenig Platz ein, widmet sich dagegen ausgiebig der Entstehung der Neuen Deutschen Welle aus Bands wie Abwärts, Fehlfarben und DAF als direkte Linie aus dem Punk. Muss man auch zuweilen lächeln, wenn Hornberger Songs von Daily Terror („Sind so kleine Biere“) einer inhaltlichen und musikalischen Analyse unterzieht, ist es doch genau dieser Ansatz, der früheren Büchern über die NDW fehlte. Schlüssig legt sie dar, warum die NDW als Stil wahrgenommen wurde, obwohl ihre Protagonisten und Werke so unterschiedlich sind wie in kaum einer anderen Musikkultur. Die deutschsprachigen Texte sind das auffälligste Merkmal und der kleinste gemeinsame Nenner – aber nicht das einzige. Durch Hornbergers Buch wird auch dem ahnungslosen Laien klar, weshalb Markus zur NDW gehörte, die Münchner Freiheit aber nicht. Und auch, warum die Welle so früh brechen musste – 1983 bezeichnete den Höhe- und Schlusspunkt der NDW, nach nur fünf Jahren war alles vorbei. Zu spät Berufene wie Paso Doble („Computerliebe“) konnten den anarchischen Wagemut der frühen Jahre nicht wiederbeleben und blieben farblose One-Hit-Wonder.
„Geschichte wird gemacht“ endet aber nicht anno ’83: im letzten Kapitel skizziert Hornberger den Einfluss der NDW auf nachfolgende Musiker und Bands. So wäre Techno undenkbar ohne DAF, der hiesige Hip-Hop zehrt vom unbefangenen Umgang der NDW mit der deutschen Sprache, und die sogenannte Hamburger Schule hätte es ohne die Neue Deutsche Welle so nicht gegeben. Und auch aktuelle Acts, seien es Mainstreambands wie Juli und Silbermond oder eher skurrile KünstlerInnen wie Ja König Ja und PeterLicht, zehren vom Erbe der NDW. Barbara Hornberger gelingt es, Fantum mit kredibler wissenschaftlicher Arbeit zu verknüpfen – „Geschichte wird gemacht“ ist eins der erhellendsten Musikbücher der letzten Jahre und sei an dieser Stelle wärmstens empfohlen. Auch denjenigen, die die NDW verachteten: die NDW war ganz anders, als ihr denkt!
Barbara Hornberger: Geschichte wird gemacht: Die Neue Deutsche Welle. Eine Epoche deutscher Popmusik. Königshausen & Neumann. Broschur, 428 Seiten, 34,90 Euro.
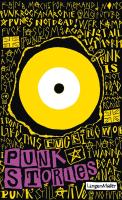 Punk Stories
Punk Stories
Erst im Rückblick wird die eigene Jugend so richtig schön – oder verwegen, tragisch, tollkühn, wild, heroisch oder alles zusammen. Meistens war sie nichts von alledem, höchstens in wenigen, kurzen Momenten. Oder die Jugendzeit war nur tragisch, aber dann will man nicht mehr darüber reden, sofern man es überhaupt noch könnte. Themen-Anthologien sind Trutzburgen der verklärten Erinnerung und der subjektiven Historisierung, vor allem, wenn es sich um Musik-Themen-Anthologien handelt: der Verlag LangenMüller geht nach „Beat Stories“ und „Rock Stories“ mit „Punk Stories“ in die dritte Runde, und erneut wurde ein mehr als 300 Seiten starkes Buch mit mal mehr, mal weniger amüsanten Geschichten gefüllt. Da ein Punk-Geschichtenbuch von deutschen Autoren zwangsläufig Überschneidungen mit der NDW aufweist, können wir die gleichzeitige Vorstellung der „Punk Stories“ mit „Geschichte wird gemacht“ bestens rechtfertigen, wenn auch Ansatz und Ausführung völlig unterschiedlich sind. In „Punk Stories“ vereinen sich Glanz und Elend des Anthologie-Gewerbes: allzu deutlich spürt man, dass die 56 AutorInnen mit dem Fangnetz eingeholt wurden, enorm sind die qualitativen Unterschiede der einzelnen Stories. Lydia Dahers ziemlich lahmer Ramones-Story ist anzumerken, dass die Autorin, die ja bekanntermaßen eine der tollsten deutschsprachigen Lyrikerinnen/Sängerinnen ist, mit Punk nur wenig am Hut hat, aber unbedingt eine Geschichte beitragen sollte. Lucy Frickes Text „Ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin“ (der Band Slime gewidmet) hingegen ist so beklemmend dicht, packend und punk-authentisch, dass er in einer Anthologie, die zum Großteil aus Pogo- und Erstersex-Erinnerungen besteht, fast fehl am Platz erscheint. Die Herausgeber stellen im Vorwort klar, dass es DEN Punk nicht gibt, weshalb man sich weder zeitlich noch stilistisch festlegen konnte und wollte, Punk ja vielmehr ein Lebensgefühl als ein Musikstil sei. Das ist gut, weil deshalb auch Stories über Bands wie die Throwing Muses, The Replacements, Hüsker Dü, Palais Schaumburg und die Modern Lovers vertreten sind, obwohl diese Bands bestenfalls an den ausgefransten Rändern von Punk entstanden/existierten. Geschichten über The Clash, die Ramones, Dead Kennedys, die Sex Pistols finden sich ohnehin. Und ja, was soll man sagen – natürlich machen viele dieser Geschichten Spaß, weil man sich irgendwo immer selbst wiederfindet. Dann rattern die Erinnerungszahnräder im Hirn und produzieren eigene Punk stories, wie zum Beispiel die, als ich damals mit drei Freunden in Papas Opel und mit vielen Büchsen Bier in die große Stadt fuhr, um (hier beliebige PUNKband hinschreiben:….) zu sehen…. Sie wissen, was ich meine. Und natürlich können Leute wie Jan Off oder Jochen Schmidt gar keine schlechten Texte schreiben. Bei Ahne bin ich mir da nicht so sicher, aber seine memorymäßige Punk-Geschichte „Wie ich wurde, was ich bin“ nahm mich mehr gefangen, als ich vermutet hätte. To cut it short: die „Punk Stories“ gehen schon in Ordnung. Aber den Ruch des Opa-erzählt-vom-Krieg-haften kann auch das knallige Cover nicht vertreiben.
Punk Stories. Herausgegeben von Thomas Kraft, Alexander Müller und Arne Rautenberg. LangenMüller. Broschiert, 317 Seiten, 14,95 Euro.
Die Website von Thomas Kraft und die von Arne Rautenberg.
Christina Mohr