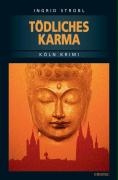 Das tödliche Karma der Kunstmörderin
Das tödliche Karma der Kunstmörderin
Nicht wirklich auf der Höhe der Zeit – Oder: Wenn Regionalkrimis ganz und gar nicht gut sind – nachdenkliche Einwürfe von Ulrich Noller
Kein Ort, nirgends: Inselkrimi, Allgäukrimi, Oldenburgkrimi, es gibt vermutlich keinen noch so abseitigen Flecken in Deutschland, der nicht zum Schauplatz für einen Regionalkrimi herhalten müsste; selbst große Verlage wie Rowohlt rennen kopflos dem schon vor Jahren abgehangenen Trend zum Regionalschmarrn nach – und vernachlässigen dabei das Eigentliche: Die Pflege einer Kriminalkultur.
Seinen Anfang nahm der Regionalkrimi als Massenkultur vermutlich in Köln: Zu Beginn der 70er Jahre formulierte der damalige WDR-Redakteur Gunther Witte sein berühmt-berüchtigtes Tatort-Papier, das (den „Dogma“-Regeln gleich) ein Dutzend Aspekte formulierte, die ein „Tatort“ zu erfüllen hat. Mit dabei: Das Prinzip der Regionalität. Mitte der 80er Jahre folgte dann der Buchmarkt, vom Fernsehen beeinflusst, zum Beispiel mit dem Kölner Emons Verlag, der das Regionalprinzip mit seinen Köln-Krimis federführend auf die Literatur übertrug. Stichwort: „Neue deutsche Heimatliteratur“.
Tödliches Karma? Neue deutsche Heimatliteratur
Und die gibt’s immer noch, zum Beispiel Tödliches Karma, der kürzlich erschienene Köln-Krimi der Journalistin Ingrid Strobl: Die Geschichte einer Drogensüchtigen, die ihren Dealer erledigt haben soll, aber unschuldig ist, weshalb sie von einer aufrechten Journalistin gerettet werden muss. Oder so. Dieser Kriminalroman transportiert zwar immerhin Wissenswertes über das Milieu, aber ein Kriminalroman ist bekanntlich keine Reportage, und erzählerisch kann dieses Buch nicht überzeugen: der Witz funktioniert selten und die Story wird von der ihr eigenen politischen Korrektheit erdrückt: der gute türkische Dealer, der fiese Borniertbulle, die unschuldige Drogenfee – tiefste 80er schimmern da durch, und genau so haben Kriminalromane schon vor 20 Jahren nicht funktioniert: als erweiterte Form des politisch engagierten Journalismus, dem die Unterhaltung höchstens ein Nebenzweck ist.
Retro? Gestrig? Schlimmer geht immer
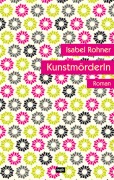 Aber es geht noch schlimmer: Kunstmörderin, der Debütroman der Kölnerin Isabel Rohner, bedient sich der Welt des Werbemilieus, in dem verkannte Autoren sich verdingen müssen, manchmal auch als Detektiv. Kennt man ebenfalls, aus den frühen 90ern, aber lustiger. Und dass dieser Roman als ironisches Spiel mit dem Genre daherkommt, funktioniert nicht, weil er nur ironisches Spiel betreibt, aber kein Genre ist und nichts zu erzählen hat – und das ist nun einmal unabdingbare Arbeitsgrundlage eines Kriminalromans.
Aber es geht noch schlimmer: Kunstmörderin, der Debütroman der Kölnerin Isabel Rohner, bedient sich der Welt des Werbemilieus, in dem verkannte Autoren sich verdingen müssen, manchmal auch als Detektiv. Kennt man ebenfalls, aus den frühen 90ern, aber lustiger. Und dass dieser Roman als ironisches Spiel mit dem Genre daherkommt, funktioniert nicht, weil er nur ironisches Spiel betreibt, aber kein Genre ist und nichts zu erzählen hat – und das ist nun einmal unabdingbare Arbeitsgrundlage eines Kriminalromans.
Wer einen post-postmodernen Kriminalroman entwerfen möchte, der mit den eigenen Existenzbedingungen spielt, der muss beides können: auf der Metaebene jonglieren und auf der eigentlichen Ebene eine richtige Geschichte erzählen. Tut er das nicht, ist’s einfach nur peinlich, denn da erhebt sich jemand über ein Sujet, das er anscheinend gar nicht kennt.
Klar, um so etwas zu vermeiden, muss man sich mit der kriminalliterarischen Kultur auseinandersetzen, und das ist hierzulande nicht sonderlich beliebt. Abgesehen davon: Auch die Reflexion der eigenen Erzählgrundlagen ist ja ein alter Hut, wirklich innovative Krimiautoren (Pouy, Pennac, Charyn) betreiben es seit Ende der 1970er, und man fragt sich: Warum ist davon nichts, aber auch gar nichts in den Köpfen der Regiokrimiproduzenten angekommen?
Neue deutsche Heimatliteratur, halt. Inselkrimi, Allgäukrimi, Oldenburgkrimi – Köln-Krimi. Nichts Neues. Nichts sonst. Kein Wort, nirgends.
Ulrich Noller
Ingrid Strobl: Tödliches Karma. Emons Verlag 2008. 255 Seiten. 9,90 Euro.
Isabel Rohner: Kunstmörderin. Trafo Literaturverlag 2008. 11,80 Euro.











