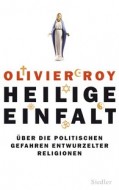 Ende der Religiosität?
Ende der Religiosität?
Ungelöste Fragen nach der „Missbrauchsdebatte“. Von Carl Wilhelm Macke
In einem Gymnasium im katholischen Münsterland. Ende der sechziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts: An der Wand neben der Schulklassentür hing ein Plakat. „Emma aus Südafrika begrüßt deutsche Entwicklungshilfe“. Emma lachte und trug ein Kleid gemustert mit lauter Hakenkreuzen. Wir fanden das Bild in der Zeitschrift „Neuss Deutschland“. Kein Schreibfehler. Es handelte sich um ein Publikation des Kabarettisten Wolfgang Neuss. Untertitel des Blatts: „Komiker aller Länder, vereinigt Euch!“
Wutentbrannt wollte der Oberstudienrat für Geschichte das Plakat herunterreißen. „Kommunistische Propaganda hat in einem bürgerlichen Gymnasium nichts zu suchen“. Gelassen hingegen der katholische Religionslehrer. Man solle das Plakat hängen lassen und über die Hintergründe deutscher Entwicklungshilfe diskutieren. Brecht stand auch im Deutschunterricht auf dem Programm. Man müsse lernen, wie die Roten argumentieren und agitieren. Über Brecht wurde ebenfalls im Religionsunterricht gesprochen. Was hat er den Gläubigen zu sagen, was sind die humanen Botschaften seiner Theaterstücke und Gedichte. Zum Beispiel die Keuner-Geschichten. „Ich habe bemerkt“, sagte Herr K., „daß wir viele abschrecken von unserer Lehre dadurch, daß wir auf alles eine Antwort wissen. Könnten wir nicht im Interesse der Propaganda eine Liste der Fragen aufstellen, die uns ganz ungelöst erscheinen?“
Verkehrte Welt
In die westdeutsche Aktualität der sechziger Jahre war diese Frage nicht so einfach zu übertragen. In der stockkatholischen münsterländischen Provinz schon mal überhaupt nicht. Es ging Brecht um die „kommunistische Propaganda“ und ihre Arroganz des Besser- und Alleswissens seiner Genossen. Der Religionslehrer ließ uns aber trotzdem eine Liste ungelöster Fragen aufstellen, um sie dann gemeinsam zu besprechen. Ein katholischer Priester, auch das gab es, führte uns in die Aufklärung hinein. Weltliche, humanistisch ausgebildete Studienräte hingegen hielten uns in der Vor-Aufklärung gefangen. Alles war gegen die ‚Gefahr aus dem Osten’ gerichtet.
Einige tobten sich auch sadistisch an uns Schülern aus. Traumen sind geblieben. Von sexuellem Missbrauch jedoch ist mir nichts bekannt. Dass heute – endlich – über diese tiefschwarze Pädagogik in sogenannten Eliteschulen, auch und vor allem mit katholischem Etikett so heftig diskutiert wird, ist unter leidlich aufgeklärten Menschen ja nur zu begrüßen. Der Winterschlussverkaufslogan „Alles muss raus!“ sollte auch über den Eingangstüren aller konfessionellen und laizistischen Bildungsinstitutionen stehen, in denen es diese Missbrauchsfälle gegeben hat.
„Die geborstenen alten Religionen“
Aber dennoch bleiben da ungelöste Fragen, zum Beispiel über das, durch die ‚Missbrauchsfakten’ ja nur beschleunigte Auseinanderbrechen der ‚alten Religionen’. Schrieb nicht Walter Benjamin schon in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts in seinem „Dialog über Religiösität in der Gegenwart: „Für uns sind in den letzten Jahrhunderten die alten Religionen geborsten. Aber ich glaube nicht so folgenlos, daß wir uns der Aufklärung harmlos freuen dürfen. Eine Religion band Mächte, deren freies Wirken zu fürchten ist.“ Welche Rolle hat die Religion also (noch) in einer säkularen Gegenwart.
„Heilige Einfalt“, die soeben erschienenen Studie des französischen Religionshistorikers Olivier Roy kann wie ein unter den aktuellen Angriffen gegen die christlichen, vor allem aber die katholische Kirche befindlicher Palimpsest gelesen werden kann. Wir erleben derzeit, so eine der zentralen Thesen von Olivier Roy, eine „militante Neuformulierung des Religiösen in einem säkularisierten Raum. (…) Säkularisierung und Globalisierung haben die Religionen gezwungen, sich von der Kultur abzulösen, sich als autonom zu begreifen und sich in einem Raum neu zu konstituieren, der nicht mehr territorial und damit nicht mehr der Politik unterworfen ist.“
Dass die ‚alten Religionen’, konkreter und wahrscheinlich auch im benjaminischen Sinne, die monotheistisch christlichen und kirchlich verfassten Religionen, auseinander bersten, ist unübersehbar. Die halsstarrige Verteidigung des Zölibats von Teilen des katholischen Klerus, vor allem in der Hierarchiespitze, ist ja nur noch lächerlich und allenfalls für eine TV-Talkrunde unterhaltsam. Noch längst scheinen nicht alle ‚Missbrauchsfälle’ in den katholischen Internaten und protestantischen Kinderchören aufgedeckt worden zu sein.
Die Wiederkehr des Religiösen
Der Frage, wie man angesichts dieser nun doch jedermann bekannten kriminellen Erziehungspraktiken im Schatten des Kreuzes heute noch einer christlichen Kirche angehören kann, ist ohne Verlegenheit kaum standzuhalten. Trotzdem aber bleibt die Frage nach dem Verhältnis von „Moderne, Säkularisierung und der Rückkehr des Religiösen“, so der Untertitel des Buches von Olivier Roy auf der Tagesordnung. Ja, vielleicht beginnt sie jetzt nach der Erschütterung der christliche Kirchen, der katholischen im Besonderen, erst so richtig aufzublühen. Roy – und man könnte hier auch den kanadischen Philosophen Charles Taylor hinzufügen – bestreitet ja ganz entschieden, dass die Bedeutung der Religion in dem Maße abnimmt, in dem die Gesellschaften säkularer, moderner, laizistischer werden. „Die Säkularisierung“, so Olivier Roy, „bringt das Religiöse hervor. Es gibt keine ‚Rückkehr des Religiösen, sondern eine Veränderung“.
Könnte es einen Zusammenhang geben zwischen zunehmender kultureller Entwurzelung und radikaler Individualisierung und einer Hinwendung zu fundamentalistischen religiösen Orientierungen? „Wie kann man erklären, daß der Pfingstglaube die Religion ist, die weltweit am schnellsten wächst? (…) Weshalb führt die ideologische Zuspitzung der Religion im Iran zu einer Säkularisierung der Zivilgesellschaft? Kurz, was passiert, wenn Religionen sich von ihren kulturellen Wurzeln lösen?“
Das Buch von Olivier Roy fasziniert und irritiert durch die Schärfe seiner vielen Fragen zu den möglichen Ursachen einer Wiederkehr des Religiösen in der globalisierten Moderne. Was erwartet uns nach der schleichenden, durch die ‚Missbrauchsdebatte’ ja nur beschleunigten Abwendung von den traditionellen Formen des Religiösen? Ist es tatsächlich ein Fortschritt, wenn nach dem tiefen Vertrauensverlust gegenüber den Institutionen des ‚alten Christentums’ jetzt evangelikale Missionare, charismatische Pfingstgläubige und einfältige Fernsehprediger mit großem Zuspruch ihre Arme ausbreiten? Und was sind die Antworten der aufgeklärten Zivilgesellschaft auf die Provokationen der fundamentalistischen Erscheinungsformen einer ‚neuen Religiösität’? „Die heilige Einfalt“, so entlässt Roy seine verunsicherten Leser aus dem Studium seines Buches „ hat eine große Zukunft vor sich.“
Carl Wilhelm Macke
Olivier Roy: Heilige Einfalt. Über die politischen Gefahren entwurzelter Religionen
Aus dem Französischen von Ursel Schäfer.
München: Siedler Verlag 2010. 335 Seiten. 22,95 Euro.











