 Get Your Kicks In The MFS
Get Your Kicks In The MFS
– Überwachen, kontrollieren, bespitzeln – und das rund um die Uhr. Das ist die Aufgabe der mit gigantischen Mitteln ausgerüsteten Geheimdienste, die dann doch alles verpatzen und verpennen, wie wir gerade am Beispiel Tunesien und Ägypten erleben konnten, wo niemand die massiven Protestbewegungen vorhergesehen hatte. So war es eigentlich schon immer, nicht nur bei der CIA oder beim britischen Auslandsdienst MI6. Auch wer für den BND oder die Stasi als Spion im Einsatz war, kann ein hübsches Potpourri an Pleiten, Pech und Pannen präsentieren, wie die Autobiographie des Doppelagenten a.D. Werner Stiller und die „Konterspionage“-Aufarbeitungen der beiden ehemaligen Stasi-Obersten Gotthold Schramm und Klaus Eichner demonstrieren. Von Peter Münder.
 Wie enorm der Einfluss von James Bond-Filmen und dem innovativen 007- High-Tech-Equipment auf die KGB-und Stasi-Mitarbeiter war, lässt sich nur erahnen. Wie der KGB-Überläufer Oleg Gordiewsky damals berichtete, war der „Bondismus“ auch bei den Spionen im Ostblock so virulent geworden, dass der KGB schließlich vier Spezialabteilungen für neuartige Waffentechnik, Spezialgifte, Geheimschriften und Überwachungstechnik ins Leben rief, um irgendwie mit Bonds High-Tech-Hexenmeister „Q“ Schritt zu halten. Auch die Ostberliner HVA (Hauptverwaltung Aufklärung des MfS) sah sich nach den ersten erfolgreichen James-Bond-Filmen (im Osten eigentlich gar nicht verfügbar gewesen) mit dem geballten Frust vieler Stasi-Mitarbeiter konfrontiert: Sie wollten auch so tolle Autos wie 007 fahren, in Kugelschreibern eingebaute Mini-Waffen einsetzen und in mondänen Absteigen mit lasziven Mädels Champagner schlürfen. Markus Wolf, der legendäre Stasi-Chef (von 1952-87), gab im Dezember 1995 in einem „Playboy“-Interview zu, einige Bond-Filme sogar als Schulungsmaterial eingesetzt zu haben: So bekamen seine Schlapphüte aus dem Plattenbau einen Eindruck von der großen weiten Welt und wussten wenigstens, was ein Martini war. Wolf war aber auch davon überzeugt, dass das kosmopolitische Playboy-Image von 007 etliche Stasi-Spione veranlasst hatte, sich in den Westen abzusetzen und zum gegnerischen BND überzulaufen. Dazu zählte der HVA-Chef vor allem seinen Top-Spion Werner Stiller, der 1979 die Seiten wechselte, nachdem er vorher schon als Doppelagent Stasi-Geheimnisse an den BND verraten hatte. Der „Schakal“ (so sein Deckname) hatte der Stasi die größte Niederlage eingebracht; er wurde jahrelang vergeblich als Staatsfeind Nr.1 gejagt und wäre in der DDR wegen Hochverrat zum Tode verurteilt worden. Plötzlich stand die Auslandsspionage-Abteilung HVA nach der Enttarnung Dutzender Agenten vor einem Desaster: Die Unterwanderung wichtiger Stellen beim BND, im Kanzleramt, bei der NATO – all das war nun durchschaubar geworden, große Teile des Spionagenetzes mit insgesamt 4200 Auslands-Agenten (!) mussten neu aufgebaut werden. Der Ost-Bond hatte ganze Arbeit geleistet.
Wie enorm der Einfluss von James Bond-Filmen und dem innovativen 007- High-Tech-Equipment auf die KGB-und Stasi-Mitarbeiter war, lässt sich nur erahnen. Wie der KGB-Überläufer Oleg Gordiewsky damals berichtete, war der „Bondismus“ auch bei den Spionen im Ostblock so virulent geworden, dass der KGB schließlich vier Spezialabteilungen für neuartige Waffentechnik, Spezialgifte, Geheimschriften und Überwachungstechnik ins Leben rief, um irgendwie mit Bonds High-Tech-Hexenmeister „Q“ Schritt zu halten. Auch die Ostberliner HVA (Hauptverwaltung Aufklärung des MfS) sah sich nach den ersten erfolgreichen James-Bond-Filmen (im Osten eigentlich gar nicht verfügbar gewesen) mit dem geballten Frust vieler Stasi-Mitarbeiter konfrontiert: Sie wollten auch so tolle Autos wie 007 fahren, in Kugelschreibern eingebaute Mini-Waffen einsetzen und in mondänen Absteigen mit lasziven Mädels Champagner schlürfen. Markus Wolf, der legendäre Stasi-Chef (von 1952-87), gab im Dezember 1995 in einem „Playboy“-Interview zu, einige Bond-Filme sogar als Schulungsmaterial eingesetzt zu haben: So bekamen seine Schlapphüte aus dem Plattenbau einen Eindruck von der großen weiten Welt und wussten wenigstens, was ein Martini war. Wolf war aber auch davon überzeugt, dass das kosmopolitische Playboy-Image von 007 etliche Stasi-Spione veranlasst hatte, sich in den Westen abzusetzen und zum gegnerischen BND überzulaufen. Dazu zählte der HVA-Chef vor allem seinen Top-Spion Werner Stiller, der 1979 die Seiten wechselte, nachdem er vorher schon als Doppelagent Stasi-Geheimnisse an den BND verraten hatte. Der „Schakal“ (so sein Deckname) hatte der Stasi die größte Niederlage eingebracht; er wurde jahrelang vergeblich als Staatsfeind Nr.1 gejagt und wäre in der DDR wegen Hochverrat zum Tode verurteilt worden. Plötzlich stand die Auslandsspionage-Abteilung HVA nach der Enttarnung Dutzender Agenten vor einem Desaster: Die Unterwanderung wichtiger Stellen beim BND, im Kanzleramt, bei der NATO – all das war nun durchschaubar geworden, große Teile des Spionagenetzes mit insgesamt 4200 Auslands-Agenten (!) mussten neu aufgebaut werden. Der Ost-Bond hatte ganze Arbeit geleistet.
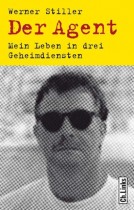 007
007
Für Stiller war der rasante Lebensstil von 007 immer ein Fixpunkt gewesen, an dem er sich orientierte, wie er jetzt in seiner Autobiographie „Der Agent“ bekannte: Nervenkitzel und Geld, das waren die beiden entscheidenden Faktoren, die seinen Job bei der Stasi überhaupt nur erträglich machten. Nur die versprochenen Auslandseinsätze im Westen, die ihm ein aufregendes Playboy-Dasein versprachen, hatten ihn als Physikstudent in Leipzig überhaupt dazu gebracht, sich als IM anheuern zu lassen. Jedenfalls war der jetzt 64jährige Stiller, der sich nach seinen BND- und anschließenden CIA-Aktivitäten in den USA als Investment-Banker bei Goldman Sachs sowie den Lehman Brothers betätigte und inzwischen in Ungarn lebt, zwar früh in die SED eingetreten, aber nie linientreuer Parteigenosse oder überzeugter Stalinist gewesen. Als „Kundschafter des Friedens“, wie die Stasi-Spione in der DDR offiziell hießen, verstand sich Stiller jedenfalls nicht. Er sah die Karriere als Meisterspion einfach als optimalen Ausweg aus der dumpfen DDR-Tristesse. Das Täuschen, Tricksen und Ausspähen war ihm schon früh zur zweiten Natur geworden. Was ihn zu Höchstleistungen anspornte, war die Aussicht auf extreme Nervenkitzel: „An dieser Stelle habe ich offenbar einen Webfehler. Während andere Menschen dafür zahlen, Risiken zu vermeiden, gebe ich Geld aus, um das Risiko zu erleben“, notiert er, als er sich in den USA mit CIA-Unterstützung unter anderem Namen (als Peter Fischer) eine neue Existenz als Banker und Broker aufgebaut hatte.
In dieser Spätphase, als er in St. Louis Englisch lernte, für seinen MBA (Business Administration) studierte und seine HVA-Erkenntnisse an die CIA verriet, konnte er dann endlich so leben, wie der kleine Fritz sich das Hedonisten-Dasein eines James- Bond-Imitators immer schon vorstellte: Als Broker und Zocker konnte Stiller seine hohen Gewinne mit vollen Händen verschleudern, sich Häuser in London und Nizza zulegen, einen Pilotenschein machen, Wasserski fahren, Tiefseetaucher werden und natürlich auch einen echten US-Straßenkreuzer fahren- da staunte der Nachbar am Prenzlauer Berg, der zehn Jahre auf seinen Trabi warten musste! Aber Stiller macht aus diesem abenteuerlichen Stoff, von dem Drehbuchschreiber in Hollywood nur träumen können, einen spannenden, streckenweise auch selbstkritischen Rückblick, der sich zudem differenziert mit dem Blockdenken während des Kalten Krieges auseinandersetzt. Nichts schien damals angesichts eines übermächtigen, allgegenwärtigen Feindbildes unmöglich: Hirnrissige Überwachungen und Bespitzelungen, permanente Ausweitungen einer hochgerüsteten Big-Brother-DDR-Kampfzone gegen die eigene Bevölkerung, eifriges Anwerben neuer IM, um mit Industriespionage möglichst schnell und billig den Know-How-Vorsprung der BRD wettzumachen. Der hehre Zweck einer sozialistischen Beglückungs-Hierarchie ohne kapitalistische Ausbeutungsgräuel sollte all diese von einem Klüngel machtbesessener, seniler Bürokraten angeordneten Mittel rechtfertigen. Und irgendwann entschloss sich Stiller dann, als er das hamsterartige Strampeln im angerosteten Tretrad satt hatte, die Seiten zu wechseln. Der akribische Techniker musste dann jedoch nach den ersten Kontaktversuchen zum BND feststellen, dass er es mit einer Truppe von unbedarften Stümpern (ist BND vielleicht ein Kürzel für Bloß Nicht Denken?) zu tun hat, die tote Briefkästen für alle sichtbar angelegt hatte, mit plump gefälschten Papieren und Ausweisen hantiert und das Deponieren extrem wichtiger Unterlagen im Klo eines westdeutschen Transit-Zuges anordnet, der überhaupt nicht in der DDR hält – immer muss Stiller als cleverer Mann fürs Grobe in letzter Minute improvisieren und sich rettende Alternativen zurechtbasteln. Mit Erfolg: Die Flucht in den Westen mit der damaligen Ehefrau klappt dann doch noch, wenn auch auf getrennten Wegen. Und eigentlich auch nur, weil die Stasi damals im Januar 1979 über keine Winterreifen verfügte und die Verfolgung des flüchtigen „Schakals“ auf verschneiten und vereisten Straßen nicht aufnehmen konnte. Immerhin kontrollierte die Stasi damals aber 460 000 Postsendungen, um verdächtigen Briefen auf die Spur zu kommen, die Aufschluss über seine BND-Kontakte liefern sollten.
Als Führungsoffizier, stellt Stiller fest, habe er bei der Auswahl seiner IM immer darauf geachtet, ob seine Kandidaten die für diesen Job erforderliche „Befähigung zur aktiven Schizophrenie“ besaßen – die er selbst notgedrungen perfektioniert hatte, um im Konflikt zwischen den beiden Systemen nicht zerrieben zu werden. Den kritisch-analytischen Blick für menschliche Schwächen hat der mehrmals verheiratete Schürzenjäger mit den unzähligen Affären auch nicht verloren. So abgeklärt wie Hegel in seiner Blütezeit über den omnipotenten Weltgeist, urteilt Stiller über die allseits florierende „materielle Interessiertheit“: „Die Gier steckt tief im Menschen“, befindet er und mokiert sich über die oberschlauen Börsen-Gurus unserer Tage: „ Alle sogenannten Experten, die sich im Fernsehen hinstellen und den Stand des Dow Jones Index oder des DAX vorhersagen, sollten besser im Zirkus als Wahrsager auftreten. Mir wurde klar, dass die Welt um uns herum höchst komplex ist und mit linearen Modellen nicht beschrieben werden kann. Das deckte sich mit meinen Geheimdiensterfahrungen. Man konnte noch so gut versuchen, alles eigene Handeln vorher zu planen und die denkbaren Varianten der Gegenseite genau durchzuspielen, am Ende entschied oft ein unvorhergesehener Zufall“. Dieser Super-Agent a.D., der hier so erfrischend mit selbstkritischer Bodenhaftung aus dem Nähkästchen plaudert, ist eben kein rechthaberisch-dogmatischer Dr. Allwissend. Dazu passt dann auch, dass er nun in Budapest mit einer neuen Frau zusammenlebt und im letzten Satz seiner Autobiographie feststellt: „Ich kann mir gut vorstellen, noch mal in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent zu leben. Das Abenteuer geht weiter.“
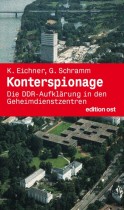 Gegenspionage
Gegenspionage
Die Lektüre des Bandes „Konterspionage“ mutet dagegen an wie das Aktenstudium griechischer Subventions-Anträge für Ananasplantagen auf Kreta. Die beiden ehemaligen Stasi-Obersten Eichner und Schramm haben das Desaster des Falls der Mauer offenbar immer noch nicht verarbeitet und können es nicht fassen, dass ihr Spionage-Bollwerk gegen den imperialistischen Klassenfeind fast über Nacht pulverisiert wurde. Dabei spielten sie als Meister der Gegenspionage doch in der ersten Liga, der „Königsklasse“ unter allen Diensten! Und waren sie nicht viel tüchtiger, brutaler, cleverer als alle anderen? So schleicht sich ein fast wehleidiger Ton in ihren Rückblick, der obendrein noch im betulichen Beamtendeutsch gestrickt ist. Alle Manöver und Machenschaften werden immer noch so gerechtfertigt, wie man es im Kalten Krieg praktizierte: Der allmächtige Feind, die BRD, wollte die allein auf Frieden und Gerechtigkeit fixierte DDR vernichten, also war eben alles erlaubt, was diese perfide Aggression verhindern konnte. Und die eigenen, unermüdlich tätigen Kundschafter waren doch im Vergleich zu den Pullacher Patzern die echten Profis und allen westlichen Schlapphüten immer überlegen gewesen, „auch wenn die westlichen Geheimdienste keineswegs völlig erfolglos waren“, wie es so schön heißt. Eichner und Schramm wollen zwar einige bisher unbekannte, aufsehenerregende Fälle beschreiben, sie geraten aber immer wieder in das Rechtfertigungs-Raster, das auf Vergleiche, Aufzählungen und wehleidige Bestandsaufnahmen hinausläuft. Mit einschläfernder Gründlichkeit wird „der lange Weg zur Gründung der Abteilung IX der HVA“ beschrieben, lässt man sich ein auf grobskizzierte Aufbaustrukturen bei den Schlapphüten vom Verfassungsschutz und MAD ein, um dann neuere Hi-Tech-Errungenschaften wie ferngesteuerte Bodensensoren oder Funktechnik beim Verfassungsschutz zu beschreiben. Spannend sind dagegen die Dossiers zu einigen Doppel-Agenten, die von der HVA direkt beim BND eingeschleust waren und wichtige Operationen und Planungen direkt nach Ost-Berlin weitermeldeten.
DDR – guttt!
So war die vom gerechten DDR-System überzeugte Politikwissenschaftlerin Gisela Gast neben Günter Guillaume wohl die effizienteste Top-Agentin. Sie hatte direkten Zugang zum Kanzleramt, referierte die wöchentliche Nachrichtenlage bei Helmut Kohl und informierte das HVA regelmäßig über wichtige politische Entscheidungen aus dem Bonner Machtzentrum. Gast hatte für ihre Dissertation über „die Rolle der Frau in der DDR“ viele Reisen in die DDR unternommen, war vom HVA angesprochen und angeworben worden und rechtfertigte ihre Spionage für die DDR mit der Bespitzelung unliebsamer westdeutscher politischer Gruppierungen durch den BND: „Pullach trat die freiheitlich-demokratische Grundordnung mit Füßen, indem der Auslandsnachrichtendienst unerlaubt, also illegal, Inlandsaufklärung betrieb. So wurden beispielsweise die oppositionelle SPD konspirativ überwacht und für konservative Kräfte dubiose Dossiers angefertigt“, schrieb sie in ihrem 1999 veröffentlichten Buch „Kundschafterin des Friedens“ . Sie wurde erst 1990 verhaftet und 1991 zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, weil die Stasi noch kurz nach dem Kollaps der DDR die meisten Unterlagen über sie vernichten konnte. In einem im Band abgedruckten Vortragstext von 2007 echauffierte sie sich noch über das vom BND aufgebaute Feindbild und eine in Pullach grassierende Paranoia, die dazu führte, dass der BND „hinter jedem Baum und Strauch den nachrichtendienstlichen Gegner witterte, und das war zuvorderst die HVA“. Ihr Fazit ist das einer lernresistenten Dogmatikerin, die sich auch nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch eines pseudosozialistischen Polizeistaates in ihrer Rolle als „Kundschafterin des Friedens“ bestätigt fühlt: “Das Ziel der HVA und ihrer Kundschafter an der unsichtbaren Front – nie wieder Krieg in Europa und schon gar nicht von deutschem Boden ausgehend – wurde trotz ihres unrühmlichen Endes erreicht. Erst mit der Wende wurden sowohl Krieg in Europa als auch eine deutsche Beteiligung daran wieder möglich. Seitdem müssen die Verteufelung der DDR als angeblicher „Unrechtsstaat“ und die rechtswidrige massive Strafverfolgung von hauptamtlichen und inoffiziellen Mitarbeitern ihrer Auslandsnachrichtendienste dazu herhalten, die ostdeutsche Auslandsaufklärung zu denunzieren“.
Zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen ehemaliger HVA-Spione und deren Rückblicke auf den Kalten Krieg also. Keine Frage: Werner Stiller, dieser Möchtegern-James-Bond auf der Suche nach dem ultimativen Kick, beschreibt seine Abenteuer und Missgriffe nicht nur spannender, selbstkritischer und realistischer als die beiden ehemaligen Stasi-Bürokraten oder die frühere Top-Agentin Gisela Gast. Er käme auch nie auf die Idee, mit penetrantem missionarischem Übereifer die These zu vertreten, dass am ostdeutschen Abhörwesen die Welt genesen sollte.
Peter Münder
Werner Stiller: Der Agent. Mein Leben in drei Geheimdiensten. Chr. Links Verlag, Berlin 2010. 256 S. 23 Abb. 19,90 Euro. Verlagsinformationen zum Buch
Klaus Eichner/Gotthold Schramm:Konterspionage. Die DDR-Aufklärung in den Geheimdienstzentren. Edition Ost, Berlin 2010. 288 S., 14.95 Eur0. Verlagsinformationen zum Buch












