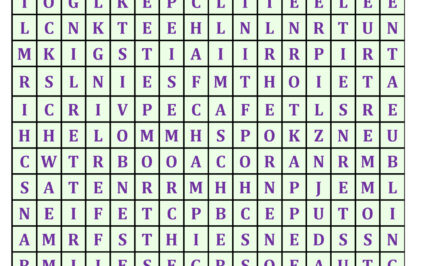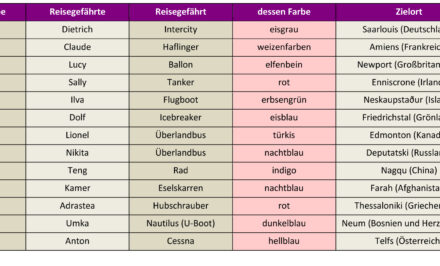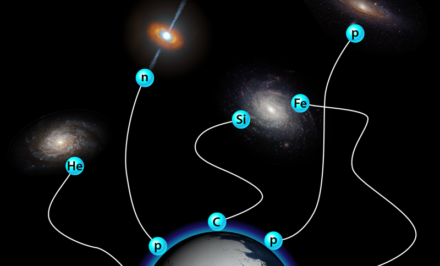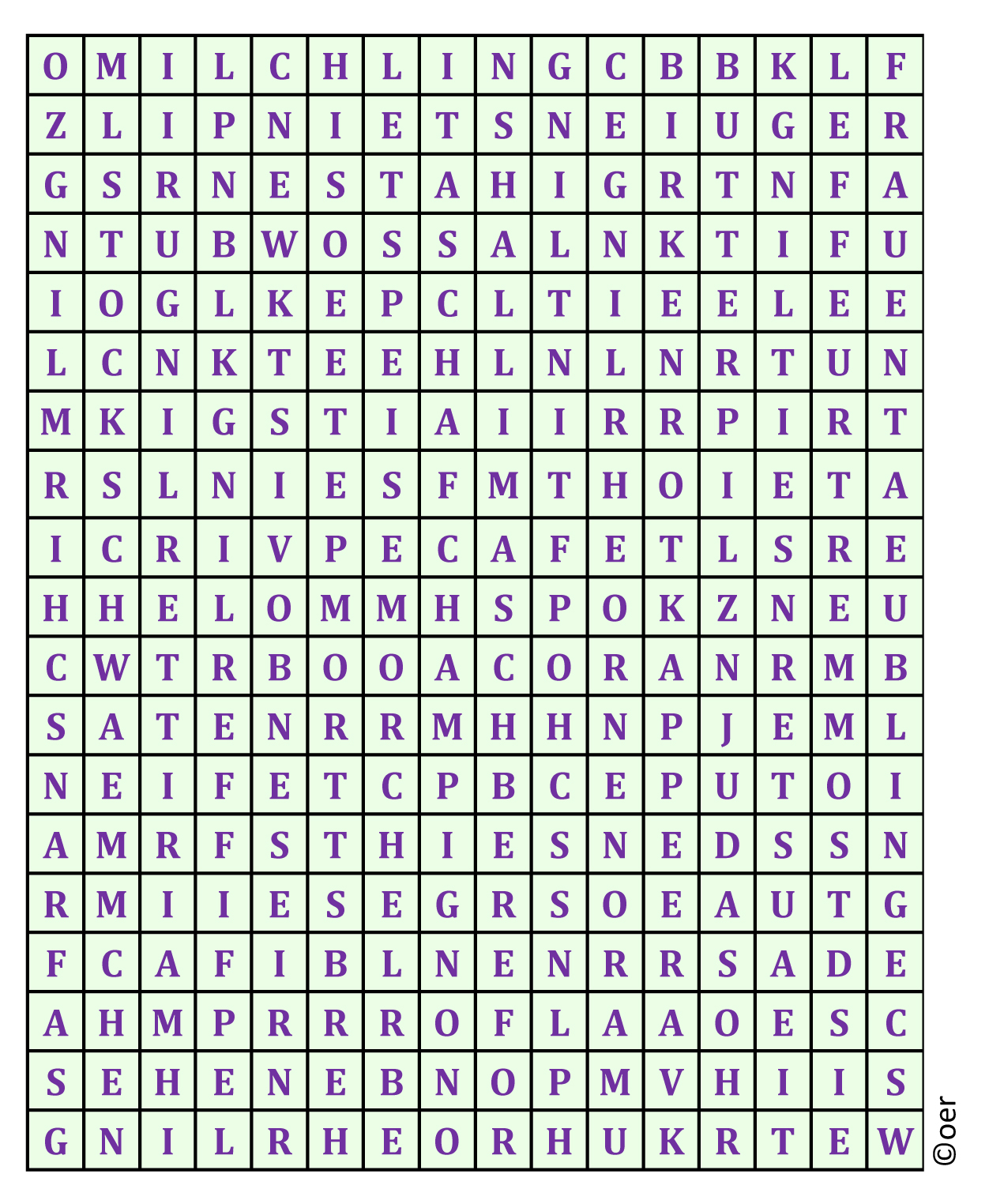Die langweilige Apokalypse
Die langweilige Apokalypse
– Science-Fiction dient häufig zum Ausmalen von Utopien, positiven wie negativen. Wenn einer der geachtetsten deutschsprachigen Autoren sich das 25. Jahrhundert zum Thema nimmt, um daran die gesamte Menschheitsgeschichte anthropologisch abzuhandeln und menschliche Eigenschaften auf ewig festzuklopfen, sind die Erwartungen hoch. Leider erfüllt Jirgl diese nicht, findet Elfriede Müller.
Reinhard Jirgl, der für seine Sprache berühmt wurde, verfremdet diese in seinem letzten Roman bis zur Unkenntlichkeit, um die Distanz zur Gegenwart zu verdeutlichen. Das Werk besteht aus einem Prolog, zwei Büchern der Kommentare und zwei Bänden: „Die Toten“ und „Dersturm“. Eine Handlung im eigentlichen Sinne ist nicht zu erwarten, darauf wird der Leser im Prolog und in den Kommentaren vorbereitet. Die Menschheit ist mal wieder auf ganzer Linie gescheitert, weil dieses Scheitern Jirgl zufolge in ihrem Wesen liegt. Als reiche die Geschichte der letzten beiden Jahrhunderte nicht aus, bewegt sie sich in den darauffolgenden bis zum 25. Schicksalsjahrhundert auf ihren Abgrund zu, der aber, wie der Titel bereits suggeriert, nicht von dieser Welt ist.
Der Ich-Erzähler, ein 25-jähriger Erdenbewohner, führt entweder einen Monolog oder einen Dialog mit dem sogenannten „Fremden“, der alles schon im Voraus weiß und es dem Ich-Erzähler altklug aufs Brot schmiert. Der Fremde steht für das Unterbewusstsein. Die ökologischen Katastrophen hat die Menschheit bereits hinter sich, zur Wende vom 21. zum 22. Jahrhundert waren die Erdschätze geplündert, Hungersnöte ausgebrochen und der Zugang zu Energiequellen versprach Macht und Geld. Der ansonsten völlig humorfreie Roman bringt zum Schmunzeln angesichts der herumliegenden toten Bäume aus Windkraftmasten und zerschlagenen Solarkollektoren. Die Sonnenkriege schließlich führten zur Trennung der überlebenden Weltenteile, dem Zentraleuropäischen Block (Z.E.B.), der Panamerikanischen Union (P.A.U.) und der Asiatischen Einheit (A.E), zu einer dritten Natur. Die Erdbewohner leben unter einer Imagosphäre, das scheint seit dem Film „Matrix“ für jegliche Science-Fiction-Literatur eine Pflicht zu sein. Während das Leben auf Erden immer unerträglicher wird, wird versucht mit Rückgriff auf imperialistische Methoden der Zwangsarbeit Mond und Mars bewohnbar zu machen. Menschen werden genetisch korrigiert, je nach Ergebnis werden sie deportiert und müssen malochen oder sie dürfen auf der Erde in ihrer Imagosphäre verweilen.
Die Beschreibung der Zwangsarbeiter wird zur Freakshow, die durch die penetrante Anhäufung von Entstellungen weder Ekel noch Mitleid hervorruft, sondern Entmenschlichung auf aufdringliche Art verdeutlicht. Der Mensch ist des Menschen Feind, egal ob er auf Erden oder auf dem Mars weilt. Die Deportierten sterben den bekannten Tod durch Schwerstarbeit, der spätestens nach sechs Wochen eintritt. Die Zeitspanne ist zu kurz für Kommunikation geschweige denn für Widerstand. Vor ca. 250 Jahren fand der erste Arbeiteraufstand auf dem Mars statt, der durch Gasexplosionen vernichtet wurde. Die Lager ähneln den Vernichtungslagern der Nazis genauso wie den Arbeitslagern des Stalinismus. Die Bergwerke auf Mond und Mars erinnern an „Metropolis“. Der Roman ist reich an Zitaten, auch Geschichte wird breit gestreut. Alle Gräuel, die Menschen anderen Menschen angetan haben, finden auch noch nach dem 21. Jahrhundert Verwendung. Philosophisch wird sich auf Sokrates bezogen, Agambens „nacktes Leben“ blitzt hinter den Beschreibungen der diversen deportierten Zwangsarbeiter hervor. Auch Heidegger lässt grüßen: „Das-Leben hat nur 1 Ziel, den Tod.“
!Luft!Luft!Atem!Luft
Weil die Erde kaputt ist, soll sie auf dem Mars reproduziert werden. Aber die Methoden, die die Erde zerstörten, werden auch auf dem Mars eingesetzt und damit das Experiment und die Zukunft zum Scheitern verurteilt. Der Ich-Erzähler wurde von seinem Vater erzogen, seine Mutter kannte er nicht und fast verliebt er sich in die Marsinvasorin, die vorgibt seine Mutter zu sein. Die Elterngeneration des Erzählers war die letzte, die noch leibliche Nachkommen schuf. Der Ich-Erzähler ist Täter, Mitarbeiter einer Behörde, die entscheidet, wer zur Zwangsarbeit deportieren wird: „Gen-Untaugliche, Energie-Vergeher, Diätetik- & Hygiene-Verweigerer“; zwischendurch ist er auch Geisel, als er auserwählt wird, zum Mars zu fliegen und dort seine neue Tätigkeit aufzunehmen als Ordentlicher Sachbearbeiter bei der Interplanetaren Wissenschaftskonferenz I.W.K., aber in einem feindlichen Gebiet landet.
Im zweiten Teil „Dersturm“ wird die Sprache zotiger, wie um zu verdeutlichen, dass es auf Mond und Mars rauer zugeht. Die vorübergehende Friedfertigkeit der Erdbewohner wird von den Marsianern als ein genetischer Defekt der Schöpfung betrachtet. Vorher wurde die Erde von Leichenbergen, Seuchen und Hungersnöten geprägt, die großen Metropolen wurden durch Piratenhorden zerstört und aufgelöst. Danach herrschte 200 Jahre Ruhe in der Imagosphäre der Erde, bis die Marsianer die Erde besetzten, die Imagosphäre zerstörten und einen Teil der Erdbewohner mit auf den Mars nahmen. Kants ewiger Friede erweist sich angesichts dessen als Chimäre. Die Rückkehr der Marsianer bedeutet auch das Ende der über 200-jährigen irdischen Völkerseparation.
Die Herrschaftskritik stockt, weil dem Menschen Eigenschaften zugesprochen werden, die nicht gesellschaftlich bedingt, sondern anthropologisch über die Jahrtausende gewachsen sind, wie der Eroberungsdrang, die Denunziation, das Sicherheitsbedürfnis. Es ist unklar, ob es sich um eine antike Diktatur mit römischen Attributen, eine Ökodiktatur oder schlicht um Faschismus handelt, der die Menschen zu ihrem Unglück zwingt: „Und Alles ist ihnen Beute das nicht ist wie sie.“
Die langatmigen Beschreibungen der Gefangenschaft auf dem Mond bringen solche Satzgebilde hervor wie: „Kehlgewürge Stick u Atemnot – mit fährigen Lungenhänden: !Luft!Luft!Atem!Luft aus dem Großenkübel der Nachtstadt grabschend, – teeriges schwer Öles Fettgeschmir & Patschulis Herbe aus Leibermulden heiß geklaubt …“
Jüngstes Gericht à la Jirgl
Nach der Gefangenschaft ist der Ich-Erzähler auf der Suche nach sich selbst, nicht zuletzt, weil er eine Gesichtsverletzung hat, die ihn unkenntlich macht, und er ein neues Gesicht erhält, das die Züge seiner Marsmutter trägt. Er zieht aufgrund der Bosheit der Menschen die Einsamkeit vor, denkt höchstens noch an seine erste große Liebe auf Erden. Etwas Spannung kommt im letzten Teil auf, als eine Marsguerilla, die die Erinnerung über Bücher bewahren möchte und der der Fremde angehört, auf den Plan tritt. Als wären der Gräuel noch nicht genug beschrieben worden, wird auf dem Mars die Reproduktionskette mit der Nahrungskette verbunden, d. h. Kleinkinder werden geboren, um an Restaurants verkauft und verzehrt zu werden, denn Tiere gibt es auf dem Mars nicht und mit Pflanzen ist es auch schwierig. Natürlich vor allem die Kinder armer Eltern. Damit glauben die Marsianer die Probleme der Nahrung und der Überbevölkerung auf einmal gelöst zu haben. Auch nach vielen Jahrtausenden scheint der Mensch nichts hinzugelernt zu haben, Deportation, Aussiedlung und Vertreibung bestimmen sein Tun, so als ob er nicht anders könnte.
Die beschriebene Menschverschrottung wahlweise aus einem Gemälde von Hieronymus Bosch oder einem ordinären Splatterfilm nimmt ihren Lauf, bis der Mars sich schließlich aufgrund eines großmannssüchtigen wissenschaftlichen Experiments in zwei Teile spaltet und auf die Erde fliegt und so die Reste irdischen Lebens mit sich reißt. Das Jüngste Gericht à la Jirgl rechnet mit den Menschen und dem Planeten Erde ab. Diese Abrechnung könnte man als Warnung lesen, aber sie beunruhigt nicht, sie verhallt in der langweiligen Redundanz von Widerlichkeiten.
Elfriede Müller
Reinhard Jirgl: Nichts von euch auf Erden. München: Hanser Verlag 2012. 510 Seiten. 27,90 Euro.