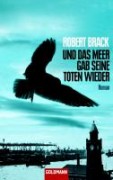 Impetus des Faktischen
Impetus des Faktischen
Über den Zusammenhang von Geschichte und Kriminalliteratur kommt Ulrich Noller ins Grübeln.
Ein Schelm, wer Verschmitztes dabei denkt: Robert Brack, Hausautor des Verlages Edition Nautilus, des Tannöd-Erfolgsverlages also, ist jetzt ebenfalls ins lukrative Geschäft mit dem Geschichtskrimi eingestiegen: Und das Meer gab seine Toten wieder. Bracks neuestes Werk spürt einer Geschichte aus den beginnenden dreißiger Jahren nach, als zwei Mitarbeiterinnen der Hamburger „Weiblichen Kriminalpolizei“ tot auf der Insel Pellworm aufgefunden wurden; ein Fall, der bis heute nicht aufgeklärt ist.
Beziehungsweise: Aufgeklärt war. Denn Robert Brack, und das ist das Besondere an seinem Roman, hat im Rahmen seiner Arbeit an der fiktiven Geschichte real-historische Recherchen angestellt. Das Ergebnis: Jede Menge 1930er-Jahre – Kontext als Substanz und darauf fußend die eine oder andere These zu Lösung des Falles. Kein schwülstiger Historienkrimi also, sondern, wie der Autor auf seiner Internetseite dezidiert betont, ein zeitgeschichtlicher Kriminalroman mit dem Impetus des Faktischen.
Verpackt hat Brack seine Näherung an die wahre Geschichte als halb literarischen, halb dokumentarischen Bericht einer englischen Polizistin. Diese – etwas naiv durchs Leben stapfende – Ermittlerin wird vom internationalen Verband der weiblichen Kriminalpolizisten nach Hamburg geschickt, um herauszufinden, warum die dortige weibliche Abteilung aufgelöst wurde und warum die Chefin sich im Hungerstreik befindet.
Leichen auf Pellworm
Dreh- und Angelpunkt der Ereignisse sind, so stellt Jennifer Stevenson fest, zwei tote Beamtinnen, die auf der Insel Pellworm gefunden wurden und die vermeintlich gemeinsam Selbstmord begangen haben. Stevenson spürt – als alter ego von Autor Brack – ihrer Geschichte nach, um die Hintergründe der Affäre aufzuhellen. Was bedeutet, dass sie die wahren Todesumstände der Beamtinnen klären muss.
Crime goes history …
Geschichte und Krimi, das sind per se erst einmal grundverschiedene, einander widerstrebende Welten, weil der Kriminalroman vor nicht allzu langer Zeit wenig geschichtsträchtig als mehr oder minder realistisches literarisches Beiwerk des postindustriellen Zeitalters entstand, nicht aber als Medium früherer Zeiten. Trotzdem, so zeigt sich in den letzten Jahren, ist der Kriminalroman gut geeignet, um Geschichte zu erzählen; was auch damit zu tun hat, dass das vermeintliche Genre sich nach aktueller literaturtheoretischer Sichtweise immer mehr zu einer Universalgattung entwickelt, die langsam, aber sicher den klassischen Roman ersetzt.
Dass ein Kriminalschriftsteller sein Genre benutzt, um nicht nur Geschichten aus der Geschichte erklingen zu lassen, sondern mit Hilfe der Fiktion selbst Geschichtsforschung zu betreiben, ist so gesehen das I-Tüpfelchen einer erstaunlichen, paradoxen Entwicklung: Seine Spannung bezieht dieser Stoff nicht nur aus seiner ästhetischen Ausgestaltung, sondern auch aus seiner real-historischen Verrätselung. Dann zumindest, wenn man sich als Krimileser für solche Fußnoten der Historie interessiert. Denn mit einem ganz grundlegenden Problem hat Und das Meer gab seine Toten wieder zu kämpfen: Dem der Relevanz.
Who cares ….?
Denn, mal ehrlich: Wen interessieren zwei tote Kripopolizistinnen, die eingangs der 30er-Jahre am Strand irgendeiner Nordseeinsel vor sich hingammeln als real-historische Episode? Wenn überhaupt, dann trägt dieses Ereignis für einen nebensächlichen Artikel auf Spiegel-Online, nicht aber für einen eigenen Roman.
Insofern unterscheidet sich Und das Meer gab seine Toten wieder bei ganz ähnlichen Voraussetzungen grundlegend von den Erfolgstiteln der Andrea Maria Schenkel: Robert Brack hat – bei aller professionellen Unterhaltsamkeit – letztlich nicht die sprachlich-dramaturgischen Mittel gefunden, um einen wenig bedeutsamen historischen Stoff so zum Klingen zu bringen, dass er als Quintessenz einer Zeit erscheint.
Ulrich Noller
Robert Brack: Und das Meer gab seine Toten wieder. Edition Nautilus 2008. 220 Seiten. 13,00 Euro.











