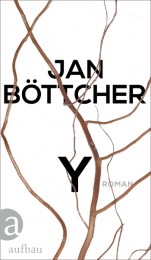 Verschenktes Potential
Verschenktes Potential
– Gibt man bei buchhandel.de „Ä“ als Suchbegriff ein, erscheint als erster Treffer Max Goldt; tippt man „F“, landet man bei Daniel Kehlmann. Nun kommt ein weiterer Ein-Buchstaben-Buchtitel auf den Markt, der sich neben der Französischkursreihe „On y va!“ erst noch seinen Platz erobern muss. Von Frank Schorneck.
Jan Böttcher, der mit der Band „Herr Nilsson“ und später auf Solopfaden für literarisches Songwriting steht und auch in seinen bisherigen Romanen und Erzählungen musikalisches Gespür bewies, hat sich diesmal von einem literarischen Austauschprogramm inspirieren, aber leider auch von den Eindrücken überwältigen lassen: „Grenzgänger Europa und seine Nachbarn“ lautet das Stipendienprogramm von Robert-Bosch-Stiftung und Literarischem Colloquium Berlin, das Jan Böttcher ins Kosovo und zu diesem Roman geführt hat.
Böttcher nähert sich dem Kosovo durch einen Ich-Erzähler, der wie der Autor Schriftsteller ist und in Berlin lebt. Über seinen pubertierenden Sohn macht er die Bekanntschaft mit Leka, einem Jungen, der möglicherweise von Zuhause ausgerissen ist und eines Tages spurlos verschwindet. Der Erzähler nimmt Kontakt mit Lekas Vater auf, dem Computerspieldesigner Jakob Schütte, der ihm seine Lebens- und Liebesgeschichte erzählt: 1998 in Hamburg trifft Jakob auf einer Geburtstagsfeier Arjeta wieder, für die er zu Schulzeiten bereits geschwärmt hatte. Doch erst jetzt stellt er fest, dass er über das albanische Mädchen und seine Familie, über die Geschichte ihrer Flucht aus dem Kosovo, eigentlich nichts wusste. Die beiden werden – gegen den Widerstand von Arjetas Vater – ein Paar.
Jakob kommt über die Familie Nesiri in Kontakt mit einer aktiven albanischen Community in Hamburg, nimmt aber an den Schicksalen und politischen Diskussionen kaum Anteil. Dann auch in Hamburg behalten die Albaner die Heimat im Auge und als Erzählungen von ethnischen Säuberungen und Widerstand zu hören sind, streben Arjetas Brüder nach Kosova (Jakob und auch der Ich-Erzähler verwenden konsequent die albanische Form für die Landesbezeichnung). Im Jahr 2000 zieht die Familie Nesiri zurück nach Pristina, die schwangere Arjeta trennt sich von Jakob. Dieser will die Trennung nicht wahrhaben und folgt ihr. Die örtliche Ungebundenheit seines Jobs in der Computerspielbranche ermöglicht es ihm, aus der Nähe das Aufwachsen seines Sohnes Leka zu beobachten…
Jan Böttcher gewährt der Geschichte sowohl aus Jakobs als auch Arjetas Perspektive Raum, jeweils gefiltert durch die Sichtweise des Ich-Erzählers, der beide befragt und sich schließlich sogar selbst gemeinsam mit seinem Sohn auf Spurensuche in Pristina begibt. Dennoch bleiben die Figuren ungewöhnlich blass. Man merkt dem Roman an, dass Böttcher bemüht ist, die politischen Umwälzungen im Kosovo einzuflechten, einen bereits von der deutschen Öffentlichkeit wieder vergessenen Krieg vor den Toren Europas wieder in Erinnerung zu rufen. Dabei verliert er allzu oft das Erzählen aus dem Auge und reiht Ereignisse recht buchhalterhaft aneinander. Dass der Ich-Erzähler ein Mann des geschriebenen Wortes sein soll, ist kaum nachvollziehbar, so naiv nähert er sich seinen Quellen Jakob und Arjeta.
Das ist insbesondere schade, weil der Roman in nahezu erschreckendem Ausmaß in Bezug zur aktuellen zeitgeschichtlichen Situation steht, was manchmal auch direkt angesprochen wird: „Die kosovarische Seele, hieß es, sei gefangen genommen von der unsensiblen Machtpolitik der Amerikaner, den unrealistischen Vorstellungen der EU und den unproduktiven Maßnahmen der eigenen Regierung. Ein Beispiel wurde benannt: Statt das Land zu schützen und zu beruhigen, hatten im Mai 2012 alle Mächte zusammen entschieden, dass syrische Rebellen Nachhilfestunden bei den alten UCK-Kämpfern nehmen sollten.“ Eindrucksvoll schildert „Y“ die Arroganz und Ignoranz, mit der Westeuropäer dem Krisenherd Balkan begegnen. Mit dem Geld seines Vaters will Jakob die Familie Nesiri geradezu kaufen, aus dem Kriegsszenario schlägt er hingegen Kapital, als er Landschaft und Waffensysteme als Schablone für ein PC-Spiel nutzt. Und auch ganz reale Personen spiegelt Jakob skrupellos in seinem Game.
Das titelgebende „Y“ greift Böttcher in verschiedenen Zusammenhängen auf, es findet sich so zum Beispiel in der Architektur oder der simpelsten Form eines Stammbaums oder eben in den drei Handlungsebenen (Ich-Erzähler, Jakob, Arjeta), die aber leider nie zu einem ganzen „Y“ verschmelzen.
Frank Schorneck
Jan Böttcher: Y. Roman. Aufbau Verlag, 2016. 255 Seiten. 19,95 Euro.











