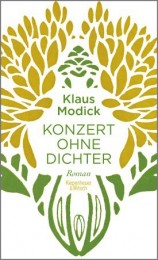 Drei Tage im Leben des Heinrich Vogeler
Drei Tage im Leben des Heinrich Vogeler
− Im Falle Heinrich Vogelers übertrifft sein Leben seine Kunst an Spannungskurven, Wendungen und Brüchen. Klaus Modick beschreibt in „Konzert ohne Dichter“ seine – im Vergleich zu dem, was folgte – langweiligen Anfänge und erzählt dabei ganz im Duktus der Akteure von der kurzen Geschichte der Künstlerkolonie Worpswede und von der Sackgasse des Jugendstils, der von einem seiner wichtigsten Schöpfer aufgegeben wird. Von Elfriede Müller.
Der Roman beschreibt Vogeler auf dem Höhepunkt seines Erfolges als Allroundkünstler: Grafiker, Architekt, Maler und Designer, der sich selbst als Teil seines von ihm geschaffenen Gesamtkunstwerks begreift und darüber reflektiert, wie er seinem eigenen Gefängnis entfliehen kann, in dem er lebt und arbeitet. Vogeler hat gerade das Gemälde Das Konzert (Sommerabend in Barkenhoff) fertig gestellt, das in Oldenburg ausgestellt wird, wo er als noch junger Mann mit 33 Jahren 1905 die Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft verliehen bekommt. Dieses Ereignis, auf das der Roman zuläuft, ist für Vogeler das Ende seiner Idylle in Worpswede, die er zwar mit initiierte, die ihm aber längst zu eng geworden ist. Modick beschreibt das Werden und den Niedergang dieser zum touristischen Mythos gewordenen Künstlerkolonie: „als arrangierte Künstlichkeit, als lukrativer Mummenschanz für zahlungskräftiges Publikum, das sich nach Natürlichkeit und Wahrheit des Landlebens sehnt, aber in Städten wohnt“.
Modick geht der Frage nach, warum das Bild, an dem Vogeler jahrelang arbeitete und das ein Konzert zeigt, nicht nach Musik klingt. Vielleicht liegt es am fehlenden Dichter, der die Künstlerkolonie endgültig verlassen hat, nachdem er einigen schon sehr auf die Nerven gefallen war. Der abwesende Dichter ist Rainer Maria Rilke, auch er wird in seinen Anfängen gezeichnet und sticht vor allem durch seine schwülstige Unerträglichkeit und seinen übersteigerten Egoismus hervor, der wenig für kollektives Arbeiten taugt. Die anderen Künstler in Worpswede bleiben bis auf eine Ausnahme auffällig blass: Paula Modersohn-Becker. „Paula macht das Kühnste und Beste, was hier in Worpswede je gemalt worden ist.“, würdigt sie der Ich-Erzähler Vogeler. Allein in ihren Bildern scheint so etwas wie Wahrheit über die Welt außerhalb der Künstlerkolonie hervor, über Arbeit und Armut. Vogeler selbst schwankt zwischen seinem Handwerkerethos und der Verpflichtung gegenüber seinem Gesamtkunstwerk, das ein Selbstläufer geworden ist.
Der Autor würdigt die beiden Malerinnen Clara Westhoff und Paula Modersohn-Becker, ohne jedoch zu erwähnen, dass Vogelers Motiv und Gattin Martha Vogeler selbst auch noch künstlerisch tätig werden wird. Rilke verliebt sich in beide Frauen, etwas mehr in Paula, aber eigentlich liebt er nur sich selbst und heiratet schließlich Clara Westhoff. Der erfolgreiche Vogeler, der sich vor Aufträgen gar nicht retten kann, erweist sich als großzügig seinen Künstlerkollegen gegenüber und vor allem dem ewig klammen und jammernden Rilke, der von Modick als konformistischer Rebell gezeichnet wird. Rilke stieß zum Künstlerdorf, als der Künstlerverein sich aus ideologischen Gründen aufgelöst hatte: die beiden völkischen Reserveoffiziere Hans am Ende und Fritz Mackensen waren dagegen, dass Frauen in den Verein aufgenommen werden und auch dagegen, dass Vogeler in freier Natur Aktzeichnungen anfertigte.
Die Beschreibung der drei Tage im Juni wird von Reflexionen Vogelers und Zeitsprüngen unterbrochen, in der die Entstehung der Künstlerkolonie, die Begegnung mit Martha und Rilke geschildert werden. Vogeler, der von Courbets L’Origine du monde und der Malerei Paula Modersohn-Beckers beeindruckt ist, will kein Künstler mehr aus dem Bilderbuch sein: „Ein Künstler, wie ihn Adel und für Kunst zahlendes und Kunst sammelndes Bürgertum sich wünschten“. Vogeler will weg vom Ornament und raus in die Welt, zuerst nach Ceylon.
Der elegant geschriebene Roman über den Preis der Kunst beschreibt den Konflikt zweier Männer in einem selbst geschaffenen Mikrokosmos, der noch nicht ahnen lässt, dass beide bald zu politischen Gegnern werden würden: Heinrich Vogeler als engagierter libertärer Sozialist, der seine Kunst bald in den Dienst einer besseren Welt stellen wird, die, wie er begreift, nicht außerhalb dieser Welt entstehen kann und Rilke als Freund des italienischen Faschismus.
Elfriede Müller
Klaus Modick: Konzert ohne Dichter. Roman. Köln 2015. Kiepenheuer & Witsch. 228 Seiten. 17,99 Euro.











