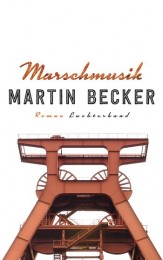 Zu den Wurzeln im Flöz
Zu den Wurzeln im Flöz
„Du hast die Welt gesehen. Du bist betrunken durch Brooklyn getorkelt und warst verliebt in Paris, in Rio de Janeiro hat man dich mit einem Messer überfallen.“ Ein junger Mann macht sich Mut für eine Reise, die nicht in entlegene Gegenden der Erde führt, sondern in entlegene Bereiche seiner Seele, seiner Familie. Er ist vertraut mit der Fremde, hat für Radioreportagen Favelas besucht und Inuit interviewt – aber die Fahrt in das Dorf im Dunstkreis des Ruhrgebietes, wo die Mutter allein im ehemals von Familienleben erfüllten Reihenhaus auf ihn wartet, zehrt an seinen Nerven. Es ist eine Reise in die Vergangenheit – in die eigene Kindheit, in die Vergangenheit seiner Eltern.
Martin Becker, der sich in seinem Debüt „Ein schönes Leben“ im Jahr 2007 bereits der Provinz annahm und sich mittlerweile als literarischer Reiseführer für Prag und Tschechien etabliert hat, widmet sich nun dem Ruhrgebiet. In drei Teilen – „Unter Tage“, „Im Schacht“ und „Über Tage“ – begibt sich sein Ich-Erzähler auf Spurensuche. Ein Erzählstrang führt in die Zeit, als seine Eltern sich kennenlernten, erzählt vom schüchternen Kohlenhauer und der selbstbewussten Näherin. Das Lebensgefühl der 1960er Jahre, die Welt des Kohlebergbaus und das Milieu der Zechensiedlungen fängt Becker wunderbar ein – ebenso den Umbruch des Umzugs aufs Land und Aufnahme einer weniger zehrenden und gefährlichen Arbeit. Ein zweiter Erzählstrang beschreibt die musikalischen Ambitionen des heranwachsenden Erzählers. Im Blasorchester des Dorfes findet der Junge seine Bestimmung. Er träumt von der großen Karriere, doch sein Talent (und seine mangelnde Bereitschaft, hart zu üben) reichen gerade aus fürs Mitmarschieren auf dem Schützenfest und das ein oder andere kleine Solo. Schonungslos legt Becker die Egozentrik des Möchtegern-Stars offen.
Die größte Stärke des Romans liegt allerdings nicht in der Bergbau-Romantik – im Gegenteil: Eine Grubenfahrt des Erzählers, das tatsächliche Eintauchen in die frühere Arbeitswelt des Vaters gerät Becker sehr distanziert und faktenorientiert wie die Abschrift von Schautafeln aus dem Bergbaumuseum. Wahre Größe zeigt „Marschmusik“ in der Schilderung der schwierigen Mutter-Sohn-Beziehung, die geprägt ist von einem Wechselspiel aus gegenseitiger Anziehung und Abneigung.
Man redet aneinander vorbei, man setzt Erwartungen in den anderen, die nicht zu erfüllen sind. Ein Hirnschlag und Koma schon vor Jahren hat die Mutter, die er früher kannte, zu einer anderen Person gemacht. Hin und wieder jedoch blitzt diese „alte Mutter“ aus ihren Augen, aus ihrer Mimik hervor. Der Sohn ist bemüht, ist sich der Verantwortung bewusst, die sein Bruder übernommen hat, der weiterhin im Dorf wohnt und die Pflege organisiert. Man sieht gemeinsam fern, besucht die Überreste eines ehemals blühenden Einkaufszentrums – und sehnt innerlich den Tag herbei, an dem man wieder in das „richtige“ Leben zurückkehren, die Enge und Leere des ehemaligen Elternhauses wieder hinter sich lassen kann. Und beim erleichterten Aufbruch schlägt dann doch wieder das schlechte Gewissen und die Sorge zu…
Frank Schorneck
Martin Becker: Marschmusik. Roman. Luchterhand 2017. 288 Seiten. 18,00 Euro











