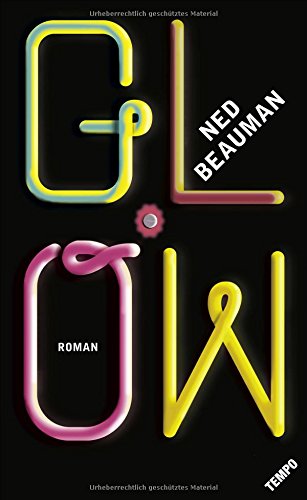 „Glow“ von Ned Beauman – Eher tell als show
„Glow“ von Ned Beauman – Eher tell als show
Von Katja Bohnet
Bein ab reicht nicht mehr
Glow heißt der heiße Scheiß, der high macht, ohne Low. In der Stadt London gehen die Partydrogen niemals aus. Genau so wie die Partys, genau so wie die Raves. Raf ist ein junger Typ, der unter einem verschobenen Tag- und Nachtrhythmus leidet. Sein Tag ist nicht vierundzwanzig, sondern fünfundzwanzig Stunden lang. Raf hatte noch nie einen richtigen Job, aber er wollte programmieren lernen. Damals schrieb er ein Programm, das die Lebens-Rhythmus-Schieflage berechnen kann. Aus dieser Abweichung von der Norm besteht also das Alleinstellungsmerkmal der Hauptfigur. Bein ab, Alkoholismus oder Stottern tun es hier nicht mehr. Yo, ihr Hipster, wisst Bescheid. Hier kommt ein fresher, englischer Hauptstadtroman. Raf hört auf einer Party das erste Mal von dieser neuen Droge „Glow“. Auf dem Rave trifft er Cherish. Die Liebe ereilt ihn, boom!, aber die Frau verhält sich zweideutig und unberechenbar. Was hat sie mit all diesen Burmesen zu tun? Wieso sieht Raf überall weiße Lieferwagen? Weshalb wird sein Kumpel entführt? Und wieso rennen plötzlich Füchse durch die Stadt?
Mehr, als man essen kann
Wer bei Ned Beauman einen Salat bestellt, bekommt ein ganzes Menü. Der Teller ist voll, randvoll. Mit Informationen, Handlung, Dialogen. „All you can eat“. Sein Protagonist jagt durch ein London, das er nicht mehr wieder erkennt, einer Wahrheit hinterher, die einem Watergate alle Ehre macht. Ned Beauman erzählt von Ausbeutung, Globalisierung und Konsum. Immer auf Tuchfühlung mit bunten Verschwörungstheorien. Hinter jeder Tür, die sein Protagonist öffnet, versteckt sich eine neue Tür. Das, was Raf erwartet, trifft jedoch nie ein. Genau so, wie in guter alter Krimitradition. Und dennoch kommt kaum Spannung auf. Das mag an Beaumans weltgewandtem Ton liegen, immer geistreich, immer witzig, gespickt mit Metaphern und Vergleichen. Ganze Sprachuniversen tun sich da auf. Das ist großartig und unbefriedigend zugleich. Ungefähr so, als habe man sich auf einer Party bei verdammt lauter Musik mit einem Akademiker unterhalten, der einen nicht entkommen lässt. Und darüber das Tanzen versäumt. Und all die anderen Partygäste. Und das Buffet.
Ned Beauman könnte auch ein „und“ veredeln. Die hektische Handlung des Romanes beleuchtet er ironisch distanziert. Diese Distanz ereilt auch die Figuren. Wenn Rafs Freundin ihn verlässt, leidet er. Aber eher in der Theorie. Sie ist DJane und geht irgendwann nach … Nur eine Stadt könnte cooler als London sein. Ironie on: Berlin. Raf behauptet also, dass er trauert. Aber man nimmt es ihm nicht ab. Jedes Gefühl wird analysiert. Egal ob Kündigung, Entführung oder Tod, alles wird sprachlich seziert. Es sterben Menschen in diesem Roman. Der Leser ist aber nicht live dabei, er erfährt es überwiegend aus dem Bericht danach. Das mag brillant geschrieben sein, locker und gut zu lesen, aber da ist kein Platz für bodenlose Trauer oder Sprachlosigkeit. Alle Figuren sind höchstens enttäuscht oder verwirrt, als gingen Gefühle nur noch einen Zentimeter unter die Haut, erreichten aber nie das Herz.
The Drugs don’t work, bloß keine Verantwortung
Theorie: Zwischen peinlicher Valentinstags-Romantisierung und intellektueller Frigidität könnte es noch andere Zustände geben. Etwas Existenzielles, das auf Hip-Sein und Wow-Sein und Total-Außergewöhnlich-Sein verzichten kann. Beaumans Figuren tragen eine Selbstverliebtheit, eine Langeweile, etwas Monothematisches in sich, das nur von Sex noch durchbrochen wird. Dann aber wird es treffend und direkt. Sex ist der Heilsbringer. Schwänze werden gelutscht, Ärsche geleckt, Kopulierende stinken. Jede Position wird beschrieben, jedes Gefühl ist überlebensgroß. Kein Wunder bei all dieser Verkopftheit. Ein Befreiungsschlag. Raf hat gelernt: Wer zu viel konsumiert, kriegt keinen hoch. Die Sexszenen retten diesen Roman.
Danach aber dümpeln die Figuren wieder an der emotionalen Nulllinie entlang. Selbst, wenn sie rennen, sterben oder feiern. Alles schon durchgespielt, alles bekannt, okay. Im Nachhinein dann nochmal darüber reden. Von der Freundin getrennt. Schon schlimm. Familie tot. Ja, ja, das auch. Was ist das? Die Generation „Ich würde gern was fühlen, aber ich weiß nicht wie“? Generation „Ich wollte gerne leben, aber ein gutes Gespräch darüber reichte mir“? Mit dreißig, vierzig immer noch daran zweifeln, ob man wirklich Verantwortung übernehmen kann? Das Risiko: zu groß. Verantwortung für eine Katze oder einen Hund, das geht gerade noch. Rose heißt der Staffordshire Bullterrier, um den sich Raf kümmert. Er trägt nicht umsonst den Namen einer Liebhaberin. Weil Tiere einfach die besseren Partner sind. Sie fordern wenig, lieben bedingungslos und vergeben gelegentliche Vernachlässigung.
Alle suchen. Aber was?
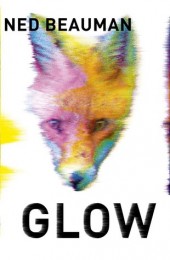 Die Gesellschaft in „Glow“ ist eher tell als show. Alle sind witzig und cool, hetero-, homo- oder metrosexuell, alle suchen noch. Nach Erleuchtung, dem besten Kick, der hippsten Location, der geilsten Musik bei Myth FM oder einer Frau. Aber in der Suche, in dem Bericht darüber, erschöpft sich der Roman. Es könnte eine traurige Bestandsaufnahme der Twentysomethings sein oder im besten Fall eine geistreiche Kritik daran.
Die Gesellschaft in „Glow“ ist eher tell als show. Alle sind witzig und cool, hetero-, homo- oder metrosexuell, alle suchen noch. Nach Erleuchtung, dem besten Kick, der hippsten Location, der geilsten Musik bei Myth FM oder einer Frau. Aber in der Suche, in dem Bericht darüber, erschöpft sich der Roman. Es könnte eine traurige Bestandsaufnahme der Twentysomethings sein oder im besten Fall eine geistreiche Kritik daran.
„Wie wirkt das?“
„Wie richtig schlechtes Ecstasy.“
…
„Wann gibt es wieder gutes Ecstasy?“
„Vielleicht nie“, sagt Isaac.
Zwischen Sachbuch und Roman
In diesem Witz liegt fast schon Traurigkeit. Mit seiner detailreichen Schilderung synthetischer Drogen oszilliert das Buch zwischen Sachbuch und Roman. Ethylbufedron, Ecstasy, Ephedrin, Methamphetamin, Pervitin, Ketamin und Meskalin. Eigentlich ein interessantes Projekt, das beides ist: fein gewebt und völlig überkonstruiert. Manchmal kommen dabei so realitätsferne Szenarien heraus, dass man vor Lachen fast ein bisschen weinen muss.
„Lacebark hat meinen Freund umgebracht. Ich weiß nicht, was die als nächstes vorhaben, aber ich will was dagegen tun. Kannst du mir helfen?“ So lautete die Nachricht, die Raf über Privatnachrichtensystem von Lotophage an Fitch sendet.
Das klingt wie bei „Fünf Freunde als Retter in der Not auf Koks“. Im letzten Viertel des Romanes kommt dann doch Spannung auf. Die letzten fünf Sätze sitzen, wie ein Maßanzug aus London auch sitzen muss. Das kommt zwar etwas spät, aber es kommt. Als habe sich das Genre endlich durchgesetzt. Hart und direkt. Gegen das überladene, geistreiche Konstrukt.
Katja Bohnet
Ned Beauman: Glow (2014). Übersetzt von Gerhard Henschel und Kathrin Passig. TEMPO bei Hoffmann und Campe, Hamburg 2017. Taschenbuch, 320 Seiten, 16,00 Euro.











