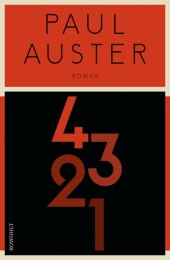 Standing at the crossroads oder Portrait des Autors als junge Männer
Standing at the crossroads oder Portrait des Autors als junge Männer
Da liegt er, Respekt heischend und wuchtig: Der neue Roman von Paul Auster. Mit über 1.200 Seiten ein ziemlicher Klotz, der als Lektüre in der Straßenbahn nur bedingt geeignet ist. Fans des Autors werden ohnehin direkt bei Erscheinen zugegriffen haben, doch worauf muss sich ein Leser einstellen, der zum ersten Mal einen Auster in der Hand hält und möglicherweise vor dem Umfang des Romans zurückschreckt? Von Frank Schorneck
„4 3 2 1“ setzt an mit einer Anekdote: Ein russischer Jude betritt am 1. Tag des 20. Jahrhunderts auf Ellis Island erstmals amerikanischen Boden. Ihm wurde auf der Überfahrt geraten, bei der Befragung durch die Einwanderungsbehörden anstelle seines echten Namens den Namen „Rockefeller“ anzugeben. Doch im entscheidenden Moment macht ihm sein Gedächtnis einen Strich durch die Rechnung und in seiner Verzweiflung platzt aus ihm das jiddische „Ich hob fargessen“ heraus. Ungerührt trägt der Beamte „Ichabod Ferguson“ in die Papiere ein und die Geschichte der Familie Ferguson in den USA kann sozusagen bei 0 beginnen. Auf den ersten Seiten mutet der Roman ein wenig an, als ziele er darauf, eine ausschweifende Familienchronik dieser Familie zu erzählen, doch schon früh taucht in Nebensätzen der eigentliche Protagonist Archibald Ferguson auf, der auf Seite 52, am 2. März 1947, geboren wird. Mit seiner Geburt endet das Kapitel mit dem Titel „1.0“, jenes Kapitel, das den Grundstein legt für die nun folgende Romankonstruktion.
Denn ab hier werden mit „1.1“, „1.2“, „1.3“ und „1.4“ vier zunächst nur in Nuancen unterschiedliche Lebensläufe eben dieses zumeist nur Ferguson gerufenen Archie Ferguson eingeleitet, denen jeweils sieben Kapitel gewidmet sind. Klingt verwirrend? Ist es aber nicht. In vier verschiedenen Versionen folgen wir dem Leben Fergusons. Es sind zunächst Faktoren aus seinem Umfeld, kleine Stellschrauben, die die Unterschiede in jeder dieser Ferguson-Variante ausmachen. So trauern wir mit dem einen Ferguson um den frühen und tragischen Verlust des Vaters, während wir in einer anderen Version seines Lebens miterleben, wie sich die Eltern bei großem wirtschaftlichen Erfolg auseinanderleben. Wir erleben mit, wie die Wahl der „richtigen“ Schule, des geeigneten Ferienlagers, die Wahl zwischen Basketball oder Baseball, der Zeitpunkt des Zusammentreffens mit anderen Personen, die weitere Entwicklung eines Lebens beeinflussen. Und Auster macht es sich nicht so einfach, lediglich seinen Protagonisten Metamorphosen zu unterziehen: Auch Nebenfiguren treffen in den verschiedenen Erzählvarianten auch hier unterschiedliche Entscheidungen. Da ist zum Beispiel Fergusons Mutter, eine energiegeladene, starke Frauenfigur, die ihr Talent zur Fotografie in dem einen Erzählstrang aus familiären Zwängen aufgibt, in einem anderen wiederum zu einer international anerkannten Fotografin avanciert.
Es gibt weitere Konstanten in Fergusons Leben. Neben der Mutter ist Amy Schneiderman die wohl wichtigste Frauenfigur, die sich je nach Konstellation und Zeitpunkt des Zusammentreffens mal zu Fergusons großer Liebe entwickelt, mal zu seiner Stiefschwester. Und als Leser hat man all diese Möglichkeiten stets im Hinterkopf, wenn man Fergusons Unsicherheiten, Ängste und Hoffnungen beobachtet. Der größte gemeinsame Nenner all dieser Ferguson-Varianten ist die Literatur. Jeder Ferguson erfährt eine literarische Initiation; auf unterschiedlichen Wegen führt ihn jeder der Lebensläufe hin zu einer Vielzahl von Autoren und ihren Werken. Und jeder Ferguson beginnt auf seine Weise mit dem eigenen Schreiben. Ob als „Herausgeber“ einer handgehefteten Schülerzeitung, als Sportjournalist, Lyriker, Übersetzer oder Verfasser von Kurzgeschichten und Erzählungen – Fergusons Lebensweg führt über welche Abzweigung auch immer stets zum Schreiben.
Der Romantitel „4 3 2 1“ erinnert an einen Countdown oder Abzählreim – und in der Tat enden die einzelnen Erzählstränge jeweils mit dem Tod Fergusons, bis nur noch einer übrigbleibt. In der Kapitelzählung werden die beendeten Lebensläufe jedoch nicht übersprungen, sondern mit der jeweiligen Ordnungsziffer und einer leeren Seite wird dem Leser sehr plakativ die Leerstelle veranschaulicht, die der Tod hier gerissen hat.
Eintauchen in die Parallelwelten der Erzählung
Es gibt mindestens zwei Möglichkeiten, sich diesem vielschichten Werk zu nähern. Man könnte Grafiken erstellen über die Verflechtungen der Personen, dem Erzählfluss mit Diagrammen zu Leibe rücken. Man kann aber diese Aufgabe auch den Literaturwissenschaftlern überlassen und stattdessen eintauchen in die faszinierende Vorstellung, dass alle diese Geschehnisse womöglich in parallelen Welten zeitgleich geschehen könnten.
Eine solche Lektüre ist fast so irritierend wie der zeitgleiche Vortrag der drei Erzählspalten in Arno Schmidts „Zettel’s Traum“ und man kann zuweilen Schwierigkeiten bekommen, die unterschiedlichen Fergusons zu identifizieren. Doch wenn man erkennt, dass letztlich die einzelnen Erzählstränge auch untereinander durchlässig sind und mannigfaltige Varianten in sich bergen, dürfte man der Intention des Autors am ehesten auf die Spur kommen.
So lässt er einen seiner Fergusons mit einem Freund über die Wahl des „richtigen“ Weges philosophieren: „Dass man nie wissen kann, ob man eine falsche Entscheidung getroffen hat oder nicht. Um das zu wissen, müsste man alle Tatsachen kennen, und um alle Tatsachen zu kennen, müsste man an zwei Orten zugleich sei – und das ist nicht möglich. (…) Nur Gott kann Haupt- und Nebenstraße zugleich sehen.“ In diesem Fall ist der Autor der Gott, der uns bei seinem Blick auf die Haupt- und Nebenstraßen im Leben seines Protagonisten über die Schulter schauen lässt: „Man selbst zu sein war schon merkwürdig, fand Ferguson, noch merkwürdiger aber war, dass es mehrere von ihm zu geben schien, dass er nicht nur der Eine war, sondern eine Ansammlung widersprüchlicher Personen, in Gesellschaft mit anderen jedes Mal jeweils ein anderer.“
Eine andere Ferguson-Version denkt in späteren Jahren, was es bedeute, man selbst zu sein: „er hatte mehrere, ja viele Identitäten, ein starkes und ein schwaches Ich, ein nachdenkliches und ein impulsives, ein großzügiges und ein egoistisches, so viele unterschiedliche Ichs, dass er am Ende so groß wie jedermann oder so klein wie niemand war, und wenn das auf ihn zutraf, traf es auch auf jeden anderen zu, soll heißen, dass jeder zugleich ein Jedermann und ein Niemand war…“
Man braucht kein Auster-Kenner zu sein, um die autobiographischen Bezüge zu erahnen, die sich beim Blick in die Biographie des Autors bestätigen. Alle Fergusons weisen Parallelen zur Person des Autors auf und durch die widersprüchlichen Varianten verweigert sich Auster zugleich der Frage nach dem autobiographischen Gehalt des Romans. Auf der anderen Seite macht sich Auster durch das Ausleben des „was wäre gewesen, wenn…“-Gedankens viel verwundbarer als bei einer reinen Autobiographie.
Neben der autobiografischen Lesart greift Auster intensiv die politischen und gesellschaftlichen Stimmungen auf, die in den USA der 1950er und 1960er Jahre herrschten. Der Mord an Kennedy, der Vietnam-Krieg, Studentenunruhen, Rassismus, das Gefühl, direkt vor dem Abgrund zu stehen – ein Gefühl, das heute beim Blick in die Vereinigten Staaten wieder merkwürdig aktuell ist.
Wer den Auster der „New York-Trilogie“ liebt, wird die doch über weite Strecke sehr konventionelle Erzählweise möglicherweise ermüdend finden, erst kurz vor dem Ende des Romans lässt er den letzten verbliebenen Ferguson aus seiner Rolle als Romanheld heraustreten und als Autor seines eigenen Buches agieren. Aber wer sich einlässt auf die Weitschweifigkeiten, auf die Wiederkehr bekannter Motive in wechselnden Situationen, erhält die einmalige Gelegenheit, ein Schicksal in mehreren Varianten erzählt zu bekommen.
Stephen King hat in „Friedhof der Kuscheltiere“ eine eindrucksvolle Sequenz geschrieben, in der es zunächst den Anschein hat, ein drohender Autounfall sei in letzter Sekunde verhindert worden und das Leben der Protagonisten sei friedlich weitergegangen – bis etliche Seiten später mit voller Wucht die Erkenntnis einsetzt, dass der Unfall eingetreten und tödlich war. Indem Auster fortwährend zwischen den unterschiedlichen Ferguson-Lebensläufen hin- und herwechselt lässt er ein ähnliches Gefühl aufkommen – allerdings um ein Vielfaches potenziert.
Frank Schorneck
Paul Auster: 4 3 2 1. Deutsch von Thomas Gunkel, Werner Schmitz, Karsten Siegelmann und Nikolaus Stingl. Rowohlt Verlag 2017. 1264 Seiten. 29,95 Euro











