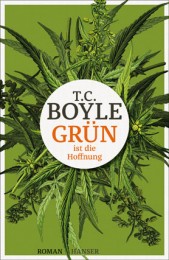 Vergebene Liebesmüh
Vergebene Liebesmüh
-T. Coraghessan Boyles Klassiker „Budding Prospects“ ist bei Hanser in einer Neuübersetzung erschienen. Die großartige Prosa hat in 30 Jahren nichts von ihrer überwältigenden Kraft eingebüßt. Von Andreas Pittler
Ich erinnere mich noch sehr gut an meine erste Erfahrung mit T.C. Boyle. Damals arbeitete ich bei der Wiener Wochenzeitung „Falter“ in der Kulturabteilung, und weil ich dort als Experte für irische Literatur galt, legte mir der Ressortleiter eines Tages Boyles „Grün ist die Hoffnung“ in der Übersetzung von Werner Richter auf den Tisch. Dies mit der Bemerkung, der Name des Autors sei ja wohl Programm.
Nun, der Roman hat so gut wie gar nichts Irisches an sich, es fließt kein Guinness in Strömen, es wird kein Whisky getrunken, niemand greift zur Fiedel, und die einzigen „little people“, die den Text bevölkern, sind Maulwürfe. Ja, nicht einmal die Protagonisten tragen irische Namen. Und dennoch hat „Grün ist die Hoffnung“ so viel typischen irischen Humor und Witz, dass man eine ähnliche Geschichte auch in Connemara oder Kerry ansiedeln könnte, dann halt vielleicht mit ein paar Jungs, die Poitin brennen und dabei ähnlich scheitern.
Doch der Stoff, aus dem in „Grün ist die Hoffnung“ die Träume sind, ist buchstäblich Stoff. Marihuana nämlich. Der arbeitslose Felix, dessen Ersparnisse unaufhaltsam dahinschwinden, sieht sich genötigt, irgendwie Geld zu machen, will er nicht fürchterlich darben. Da kommt ihm ein Angebot eines Bekannten namens Vogelsang gerade recht. Der ist irgendwie an ein Stück Brachland gekommen, auf dem er Marihuana ziehen will, mit dem sich, so locker über den Daumen gepeilt, eine glatte halbe Million machen ließe. Alles, was zu tun sei, so verklickert Vogelsang dem heruntergekommenen Hippie, sei die Pflanzen einzusetzen, darauf zu warten, bis sie gereift sind und dann zu ernten.
Nun, das kann ja wohl nicht allzu schwer sein, denkt sich Felix, der in der Übersiedlung aus der Stadt auf das Land eine willkommene Abwechslung sieht. Er heuert zwei Freunde, Phil und Gesh, gleich ihm ziemlich abgebrannt, an, und schon kann die Reise ins „Sommerlager“, wie Felix die Landpartie euphemistisch nennt, beginnen.
Doch schnell zeigt sich, dass sich die drei Jungs keine Vorstellung davon gemacht haben, was es heißt, einem brachen Stück Land einen nennenswerten Ertrag abzutrotzen. Also, wenn man ein verweichlichter Städter ist. Allein schon das Pflügen erweist sich als herkulische Aufgabe, die verschärft wird durch die sengende Sonne, die Unebenheit des Terrains, die zahlreichen Steine, die da sinnlos herumliegen und vor allem auch durch die argwöhnischen Blicke der Nachbarn, die den Städtern schon allein deswegen nicht über den Weg trauen, weil sie eben Städter sind.
Abend für Abend kriechen die drei erschöpfter in ihre Hütte. Sie erleben einen „cold turkey“ ganz anderer Art. Jede Faser ihres Körpers schmerzt, doch nicht aufgrund des Entzugs, sondern ob der völlig ungewohnten Arbeit. Und Felix ertappt sich erstmals bei der Frage, ob der zu erwartende Gewinn wirklich all die Schinderei überhaupt wert ist.
Damit freilich nicht genug. Kaum sind die Setzlinge in die Erde gebracht, beginnt ein neues Martyrium. Maulwürfe nagen die Wurzeln an und zwingen die drei zu Extraschichten in Sachen Feldwache. Und zeigen sich oberhalb der Erde endlich die ersten Keimlinge, finden sich auch Vögel ein, die sich an den Pflänzchen gütlich tun wollen. Wind und Regen tun ein Übriges, um den potentiellen Ertrag weiter zu minimieren, Felix hat eine eher gruselige Begegnung mit einem kiffenden Bären, und die Polizei entdeckt ebenfalls ihr Interesse an der merkwürdigen Plantage.
Felix wähnt sich mehr und mehr in der Hölle, als plötzlich Petra auftaucht, für die Felix schnell in Liebe entflammt. Doch angesichts der Umstände ist das Anknüpfen zarter Bande alles andere als einfach.
Boyles frühes Meisterwerk
Aus heutiger Sicht ist T.C. Boyle einer der ganz großen Vertreter der amerikanischen Gegenwartsliteratur, fraglos auf einer Stufe mit John Irving, Cormac McCarthy oder Richard Ford stehend. Romane wie „Willkommen in Wellville“ oder „America“ gelten als Meilensteine des neueren Romans, und erst im Vorjahr hat Boyle mit „Hart auf hart“ ein weiteres Stück epochaler Prosa vorgelegt.
Seine Anfänge, etwa „Greasy Lake“ oder „Wenn der Fluss voll Whisky wär´“ zeugen wie das vorliegende „Grün ist die Hoffnung“ davon, dass Boyle auch über einen anarchoiden Witz, hintergründigen Humor und einen Hang zur Romantik hat, die dieses Buch so liebenswert machen. Und wenn man mit Boyle spricht, dann merkt man, er hat sich all diese Tugenden bis zum heutigen Tag bewahrt, auch wenn sie in seinen neueren Werken vielleicht nicht mehr so offensichtlich zutage treten wie vor 20, 30 Jahren, was wohl auch nicht zuletzt daran liegt, dass die 80er trotz allem lustiger und unbeschwerter waren als unsere Tage.
Dass Hanser diesen Klassiker neu aufgelegt hat, ist ein Segen. Und die Übersetzung von Dirk van Gunsteren wird dem Originaltext durchaus gerecht. Fairerweise sei jedoch angemerkt, dass dies auch für Werner Richters Übersetzung gilt. Egal mithin, zu welcher Edition man greift – zum Original, zur Richter- oder zur van Gunsteren-Übersetzung, man wird sich auf jeden Fall königlich amüsieren und sich darüber freuen, ein geniales Buch vor sich zu haben.
Andreas Pittler
T. Coraghessan Boyle: Grün ist die Hoffnung (Budding Prospects, 1984). Deutsch von Dirk van Gunsteren. Hanser Verlag, München 2016. 383 Seiten. 24,99 Euro.












