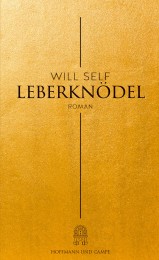 Joyces Heiligsprechung in Zürich
Joyces Heiligsprechung in Zürich
— „Roman“ steht auf dem neuen Buch von Will Self – dabei handelt es sich bei dem auch im englischen Original „Leberknödel“ betitelten Text eher um eine Novelle. Ursprünglich wurde er veröffentlicht in einem Band mit vier Prosatexten, die sich dem größten unserer inneren Organe widmen, der Leber. Dass der deutsche Verlag diese inhaltliche Klammer aufgebrochen und sich dazu entschieden hat, „Leberknödel“, den mit Abstand längsten Text des Bandes, einzeln zu veröffentlichen, ist schade – nicht zuletzt wird dem deutschsprachigen Leser so unter anderem eine Story vorenthalten, die aus der Sicht des Hepatitits C-Virus geschrieben wurde. Aber „Romane“ lassen sich offenbar leichter verkaufen… Von Frank Schorneck
Abgesehen von der irreführenden Gattungsbezeichnung ist die Gestaltung des Buches rundum gelungen. Das handliche Brevierformat, der Goldton des Umschlags sowie das von Titel und senkrechter Linie angedeutete Kreuz auf dem Cover verleihen dem Band die Anmutung einer Bibel oder eines Gesangbuches. Die Form folgt dem Inhalt, denn der Aufbau der Novelle in acht Abschnitten von Introitus bis Communio greift die Satzfolge einer Requiem-Vertonung auf.
Will Selfs literarische Totenmesse geleitet die Engländerin Joyce Beddoes nach Zürich. Sie ist unheilbar an Leberkrebs erkrankt und hat einen Termin in einer Sterbeklinik. Auf dieser vermeintlich letzten Reise wird die siebzigjährige Witwe von ihrer Tochter Isobel begleitet. Die Mutter-Tochter-Beziehung ist angespannt: Isobel war stets der Liebling des Vaters, Joyce hingegen blickt mit unverhohlener Abscheu auf „das pummelige Ding“, den „schlabberigen Hals“ und das Haar, das „auf ihrem runden Schädel wie Zuckerwatte bröselte“. In Joyces Augen ist Isobel eine gescheiterte Künstlerin, die nur darauf wartet, zuhause das Erbe zu verjubeln. Als Joyce, mit Pralinés und einem Anti-Brechmittel auf den Abschied eingestimmt, das Glas mit dem tödlichen Gift bereits in den Händen hält, widerruft sie aus einem Impuls heraus ihre Entscheidung. Sie lässt die Anzahlung auf ihren Tod verfallen, bricht mit ihrer Tochter und schüttet sämtliche Medikamente ins Klo. Seltsamerweise bringt der Verzicht auf Medizin eine Besserung ihres Gesundheitszustandes mit sich – und als sie auf einem ihrer Streifzüge durch Zürich an einer kleinen Kapelle die Bekanntschaft eines merkwürdigen, aber freundlichen Paares macht, wechselt sie mit dessen Hilfe vom Hotel in eine private Unterkunft. Erst nach und nach merkt Joyce, dass das tiefgläubig katholische Grüppchen, das sich ihrer angenommen hat, an der Seligsprechung der verstorbenen Tochter ihrer Zimmerwirtin arbeitet. Die wundersame „Heilung“ Joyces, die immer offensichtlicher zutage tritt, wurde bereits an höchster Stelle als Beleg eingereicht, ein päpstlicher Ehrenkaplan bittet Joyce um die Einwilligung zu Untersuchungen.
Bei all dem soll Joyce nicht nur als Beweis für die Wunderwirkung einer verstorbenen jungen Frau herhalten, sondern auch instrumentalisiert werden gegen die organisierte und gewerbsmäßige Sterbehilfe. Zudem wird sie in die merkwürdige Beziehung des katholischen Paares hineingezogen, was in einer tragikomischen Sexszene im Umfeld des Frühjahrsfestes „Sechseläuten“ gipfelt.
Zwischenzeitig begegnet Joyce ihrer Tochter wieder, die nicht den Flieger zurück nach England bestiegen hat, die stattdessen – im krassen Gegensatz zu Joyces Aufblühen – dem Alkohol anheimgefallen ist und nun auf der Straße lebt. Isobels Absturz scheint Joyce nicht zu wundern, kommt für den Leser jedoch unvermittelt. Eine Alkoholsucht seiner Figur deutet Self vorher nicht einmal an – und den Genuss überteuerter Gin Tonics an einer Hotelbar wird man am Vorabend eines geplanten Selbstmordes sicherlich jedem zugestehen.
Dies ist nicht die einzige Stelle, an der Self sprunghaft und plakativ erzählt, wo er Zwischenschritte auslässt und ins Gleichnishafte verfällt. Dies verwundert, da der Autor ansonsten sehr viel Wert auf Nuancen legt und das Leben in Zürich sehr detailverliebt darstellt.
Auf den Fußspuren von James Joyce durch Zürich
Der irische Kunst- und Literaturblogger Paul Doolan ist dem Gleichnishaften nachgegangen und stellt Erstaunliches fest: Denn während ich selbst den Sachverhalt „Joyce in Zürich“ für eine kleine literarische Anspielung gehalten und darüber geschmunzelt habe, legt Doolan in einem Essay minutiös dar, dass die gesamte Novelle den Fußspuren von James Joyce durch Zürich folgt. In dieser Lesart wird aus Isobel, die mehr und mehr verwahrlost und schließlich in Untersuchungshaft landet, die literarische Entsprechung von James Joyces Tochter Lucia, die erstmals in Zürich wegen Schizophrenie behandelt wurde. Wer – möglichst erst nach Lektüre des Buches – in diese Lesart eingeführt und mit auf einen Spaziergang von der Kronenhalle zum Friedhof Fluntern genommen werden möchte, findet den Essay auf der Seite des Autors selbst: http://will-self.com/2009/10/22/a-critical-essay-on-leberknodel-from-liver/
Die Akribie, mit der Doolan Parallelen zieht und mit der er der in Zürich beheimateten Joyce-Stiftung eine kultisch-sakrale Verherrlichung des Literaten nachweist, die dem Katholizismus nicht unähnlich ist, beeindruckt – auch wenn Doolan in seiner Argumentation ein paar Fakten für sich zurechtbiegt: So schreibt er, dass sowohl Isobel Beddoes als auch Lucia Joyce in Zürich 33 Jahre alt seien. Self hingegen scheint das genaue Alter nicht so bedeutend gewesen zu sein, denn auf Seite 9 der Novelle ist Isobel 34 Jahre alt, während sie auf Seite 31 auf lediglich 33 Lebensjahre zurückblickt. Und wenn Doolan behauptet, Joyce Beddoes bewohne in Zürich dasselbe Haus, in dem James Joyce gearbeitet hat, so liegt er mehrere Hausnummern daneben: Die Gedenktafel für Joyce ziert in Wahrheit das Haus Universitätsstraße 38, nicht die Hausnummer 29. Da nimmt sich Self also doch mehr Freiheit, als Doolan uns glauben machen will.
Ungeachtet dieser Lesart als literarischer Parodie bietet „Leberknödel“ einen bitterbösen Blick auf die heutige Schweiz: Joyce, die vor ihrer Pensionierung in einer Krankenhausverwaltung gearbeitet hat, nimmt zunächst die Ordnung, die Sauberkeit, die klare Struktur der Tagesabläufe, die höfliche Distanziertheit der Nachbarn, als sehr angenehm wahr. Doch je länger sie dort ist, desto kritischer vermag sie mit dem Blick der Fremden die bürgerliche Fassade zu durchschauen, bis sie schließlich an ihr verzweifelt – an der peniblen Mülltrennung genauso wie am überbordenden Bürokratismus.
Frank Schorneck
Will Self: Leberknödel. Übersetzung von Gregor Hens. Hoffmann und Campe 2015. 208 Seiten. 18,00 Euro.











