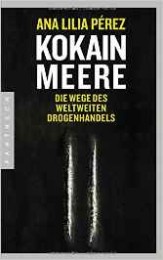 Schreiben unter Einsatz des Lebens
Schreiben unter Einsatz des Lebens
Von Jürgen Neubauer
„Wir würden ja gerne was über den Drogenkrieg veröffentlichen. Aber von mexikanischen Autoren habe ich zu dem Thema noch nie ein vernünftiges Buch in die Finger bekommen. Warum ist das so?“ fragte mich vor ein paar Jahren eine Lektorin auf der Frankfurter Buchmesse.
So platt das klang, sie hatte nicht Unrecht. In mexikanischen Buchläden liegen natürlich stapelweise Bücher über die Drogenkartelle, doch die meisten Autoren suchen sich eine schillernde Figur, eine steile These oder einen exotischen Nebenschauplatz und kratzen nicht einmal an der Oberfläche. Guter investigativer Journalismus, der im Detail über das organisierte Verbrechen und seine Verflechtungen mit staatlichen Organen berichtet, ist selten. Was daran liegen könnte, dass Mexiko für Journalisten ein sehr gefährliches Land ist.
Journalisten, die über die Narcos berichten, müssen um ihr Leben fürchten. Sie werden entführt, bei lebendigem Leib zerstückelt und in einem Müllsack auf die Straße geworfen, wie Victor Báez aus Xalapa. Sie werden aus ihren Häusern geholt, zu Tode gequält, geköpft und an Brücken aufgehängt, wie María Macías aus Nuevo Laredo. Sie tauchen unter, werden aufgespürt und „hingerichtet“, wie Fotojournalist Rubén Espinosa aus Veracruz. Redaktionen, die über das organisierte Verbrechen berichten, werden Opfer von Terrorüberfällen und Brandanschlägen, wie El Norte aus Tamaulipas oder der Radiosender Fiesta Mexicana in Sinaloa. Es ist eine schreckliche Liste, die sich noch viel zu lange fortsetzen ließe. Nach den Zahlen von Freedom House wurden in den vergangenen fünfzehn Jahren mehr als hundert mexikanische Journalisten ermordet, viele weitere sind verschwunden. Die Gewalt hat Konsequenzen: Zeitungen und Rundfunksender zensieren sich inzwischen selbst, viele Journalisten berichten nicht mehr über das organisierte Verbrechen. Andere, die es dennoch versuchen, müssen ins Ausland fliehen, weil der Staat sie nicht schützen kann oder will.
Der weltumspannende Kokainhandel
Wie Ana Lilia Pérez, die ihre Reportagen für führende mexikanische Tageszeitungen schrieb und im Jahr 2011 ein Buch mit dem Titel El Cártel Negro über die Machenschaften des organisierten Verbrechens im staatlichen Ölkonzern Pemex veröffentlichte. Noch während ihrer Recherchen für das Buch wurde sie mehrmals unter falschem Vorwand verhaftet und erhielt Morddrohungen. Deshalb entschied sie sich 2012, eine Einladung des internationalen Schriftstellerverbands PEN anzunehmen und Mexiko zu verlassen. Sie verbrachte zwei Jahre in Deutschland, wo sie unter anderem von der Körber-Stiftung und der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte unterstützt wurde. “Das hat mir das Leben gerettet”, schreibt sie im Vorwort zu ihrem neuen Buch, das gerade unter dem Titel Kokainmeere auf Deutsch erschienen ist.
In diesem Buch, das sie während ihres Aufenthalts in Deutschland schrieb, verfolgt Pérez die internationalen Transportwege des Kokains und zeichnet ein Bild der globalisierten Drogenmafia. Die Geschichte beginnt mit dem Aufstieg erst der kolumbianischen, dann der mexikanischen Drogenkartelle und dem Aufbau eines Seehandels, der an multinationale Konzerne erinnert. Für den Seeweg interessiert sich Pérez deshalb, weil er von Presse und Politik weitgehend übersehen wird, obwohl hier rund 80 Prozent des weltweit gehandelten Kokains transportiert werden. Der Container, das Symbol des entfesselten Welthandels, ist auch für die Kartelle das ideale Transportmittel. Akribisch zeigt Pérez, wie der internationale Drogenhandel, allen voran die mexikanischen Kartelle, Häfen und Behörden in aller Welt unterwandert, sich mit anderen kriminellen Organisationen verbündet, eine gewaltige Infrastruktur aufgebaut hat, und über alle fünf Kontinente ein riesiges Drogennetz auswirft. In der Einleitung schreibt Pérez:
Je länger ich mich mit der Schifffahrt als dem Rückgrat des Welthandels – und damit auch des Rauschgifthandels – beschäftigte, desto gründlicher konnte ich mich davon überzeugen, dass sie eine Welt für sich ist … Die Ozeane und ihre Häfen sind rechtsfreie Zonen, und das organisierte Verbrechen profitiert davon. Die zahllosen Häfen dieser Welt, in denen Kokainschmuggler ungehindert durch den Zoll kommen, sind die Drehscheiben, die den weltweiten Vertrieb und Konsum des Rauschgifts überhaupt erst möglich machen. Für diese Organisationen, die weder Sprachbarrieren noch gesetzliche Schranken kennen, ist die Welt klein und überschaubar: Sie besteht nur aus Routen für die Übergabe von Drogen, aus Häfen und Zollstellen mit Beamten, die auf ihren Gehaltslisten stehen, aus den halcones genannten Spähern, die ihre Ladungen überwachen, und sonstigen Informanten, die für sie arbeiten – weil die kriminellen Organisationen die finanziellen Möglichkeiten haben, Beamte zu schmieren, auch in Ländern, in denen man stolz auf niedrige Korruptionsraten ist.
Eine dieser internationalen Drehscheiben ist der Hamburger Hafen, dem Pérez ein eigenes Kapitel widmet. In Hamburg spricht sie mit Zollfahndern, begleitet Sonderermittler und erfährt, dass das Kokain, das mit großen Containerschiffen aus Südamerika kommt, hier zum Weitertransport nach Osteuropa auf kleinere Ostseeschiffe und Jachten verladen oder im „Ameisentransport“ über Deutschland verteilt wird. Interessanterweise floriere das organisierte Verbrechen in Hamburg besonders gut, wohl aufgrund „einer gewissen Naivität der Deutschen gegenüber dem organisierten Verbrechen“. Deutschland sei schließlich nicht Italien, meine man hierzulande. Doch auch der Hamburger Hafen ist infiltriert, auch hier arbeiten Fahnder mit der Mafia zusammen.
Das Hamburg-Kapitel ist sicher nicht das beste des Buchs und bleibt an Detailtiefe weit hinter den Kapiteln über Mittelamerika oder Spanien zurück. Doch es ist ein Puzzlestück im Bild des weltumspannenden Drogenhandels, mit dem Pérez zeigt, dass sich die Drogenmafia inzwischen wie ein Krebsgeschwür (oder wie ein multinationaler Konzern) überall festgefressen hat. Die gewaltigen Machtstrukturen und Verflechtungen, die Pérez aufzeigt, lassen den Leser fassungslos zurück.
Journalistin aus Leidenschaft
Ana Lilia Pérez ist eine leidenschaftliche Journalistin. Ihre Arbeit wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem dem Premio Nacional de Periodismo (2010), dem wichtigsten mexikanischen Journalistenpreis, sowie dem „Preis für die Freiheit und Zukunft der Medien“ der Leipziger Medienstiftung (2012). Im Vorwort zur deutschen Ausgabe von Kokainmeere schreibt sie:
Ich habe über Jahre hinweg den Journalismus unter Wahrung zweier persönlicher Prinzipien ausgeübt: Ethik und Verteidigung der Meinungsfreiheit. Aus diesem Grund habe ich lange Zeit mit Bedrohungen und Gefahren gelebt und musste lernen, unter Angst zu arbeiten; aber ich mache weiter, weil ich glaube, dass der ehrliche Journalismus eine Säule für die Demokratie und für die Zukunft eines Landes ist… Für mich ist der Journalismus der schönste Beruf der Welt. Aus diesem Grund fühle ich mich trotz der Ängste und Risiken, mit denen meine Arbeit verbunden ist, sehr privilegiert. Ich lebe immer noch, ich atme …
Inzwischen lebt Pérez wieder in Mexiko, und es bleibt zu hoffen, dass sie ihr Talent bald wieder dort einsetzt. Für mutige Journalisten gibt es hier viel Arbeit.
Jürgen Neubauer
Ana Lilia Pérez: Kokainmeere (Mares de cocaína. Las rutas náuticas del narcotráfico, 2014). Aus dem Spanischen von Katrin Behringer und Birgit Weilguny. Pantheon Verlag, München 2016. 320 Seiten, 14,99 Euro.











