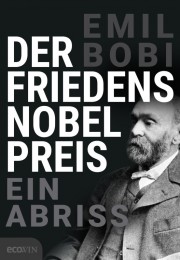 Der Friedensnobelpreis: eine „globale Meinungsmonarchie?“
Der Friedensnobelpreis: eine „globale Meinungsmonarchie?“
− Der österreichische Krisenreporter und „Profil“-Enthüllungsjournalist und Autor Emil Bobi („Agentenstadt Wien“) wirft einen kritischen Blick hinter die Kulissen des Osloer Friedenspreiskomitees und untersucht, ob die Verfügungen des Waffenproduzenten und Preisstifters Alfred Nobel für die Vergabe des Friedenspreises noch berücksichtigt werden. Denn anlässlich der jüngsten kontroversen Entscheidungen des Komitees für die EU, Barack Obama u.a. ergibt sich laut Bobi der Eindruck, dass man in Oslo die Auszeichnungen auch gern für die eigene prestigeträchtige Imagepflege instrumentalisiert. Von Peter Münder
Wenn am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel (1833-1896) , der Friedensnobelpreis an das tunesische Dialog-Quartett vergeben wird, dürften kaum Proteste oder Enttäuschungen wegen dieser Entscheidung zu erwarten sein – es hat diesmal zweifellos die Richtigen getroffen, die sich zielstrebig und tolerant für Frieden in Nahost und dem Rest der Welt einsetzten. Als US-Präsident Obama 2009 den Friedenspreis erhielt, konnten viele Beobachter dagegen nur verwirrt und entrüstet mit dem Kopf schütteln: Befanden sich die USA nicht in mehreren Ländern mit ihren Truppen im Krieg? Wie konnte dieser militante Interventionismus in Afghanistan und dem Irak als friedensstiftend verstanden und ausgezeichnet werden?
Keine Frage: Der Friedensnobelpreis polarisiert gelegentlich, seine Verleihung erregt jedoch weltweites Aufsehen und setzt im globalen politischen Spektrum ein wichtiges Zeichen, oft genug auch einen Kontrapunkt, der gezielt gegen autokratische Machthaber oder Militärregime gerichtet ist: Mit der Vergabe an den chinesischen Autor und Systemkritiker Liu Xiaobo 2010 brüskierte das Osloer Komitee die chinesischen Machthaber, die prompt einen Boykott norwegischer Lachs-Importe beschlossen und die diplomatischen Beziehungen kappten; mit der Ehrung des US-Präsidenten Barack Obama machte man Furore und löste gleichzeitig einen Sturm der Entrüstung aus: Die Streitkräfte der USA befanden sich ja, wie Obama selbst konstatierte, im Krieg mit Afghanistan und dem Irak und waren auch auf anderen Nebenschauplätzen mit militärischen Einsätzen stark engagiert. Daher deutete Obama in seiner Dankrede ja auch selbst an, vielleicht der falsche Preisträger für den Frieden zu sein. Irritationen gab es auch, als 2014 die für ihre Bildungsoffensiven und gegen Kinderunterdrückung kämpfende pakistanische Bürgerrechtlerin Malala Yousafzai den Friedenspreis erhielt.
Bobi war dabei, als das Preiskomitee diese Entscheidung verkündete und Pressevertreter den Komitee-Chef Thorbjörn Jagland kritisch befragten, inwiefern diese Preisträgerin irgendetwas für die von Nobel geforderte Abschaffung von Armeen erreicht hätte? Was hat die bildungspolitische Forderung, Kinder in die Schule zu schicken, mit dem Weltfrieden zu tun?
Und Bobi weitet seine kritische Perspektive noch weiter aus, wenn er fragt, inwiefern das Nobelkomitee überhaupt noch die in Alfred Nobels Testament postulierten Forderungen erfüllt. Seine Verweise auf diverse historische Fehlentscheidungen (Kein Preis für Gandhi, Friedenspreis für den Heißluft-Experten Al Gore und seine Warnung vor „Global Warming“) wirken mitunter überzogen, aber man fragt sich natürlich schon, weshalb das Komitee nicht auf die Idee kam, dem während des Vietnamkriegs von Nixon verbissen bekämpften und verfolgten Whistleblower Daniel Ellsberg (Autor der „ Pentagon Papers“) den Friedenspreis zu verleihen. Und warum eigentlich nicht Costa Rica, dessen Staatschef 1949 die Armee des Landes aufgelöst hat? Auch Grenada, Mauritius und Panama, ergänzt Bobi, kämen ja als Preiskandidaten in Frage: Denn sie haben ihre „stehenden Armeen“ abgeschafft. „Spielt hier vielleicht die Militärdoktrin der NATO eine Rolle?“ fragt Bobi.
Seine Kritik an einigen Entscheidungen des Komitees sollte aber nicht ausblenden (wie er es tut), dass die Auszeichnung mit dem Friedenspreis für verfolgte und diskriminierte Preisträger als Schutzschild wirken kann: Der Friedensnobelpreis hat der burmesischen Bürgerrechtlerin Aung San Suu Kyi und ihrer demokratischen Protestbewegung weltweite Beachtung und Unterstützung eingebracht und nun auch einen überwältigenden Sieg bei den Parlamentswahlen.
Gegen Bestimmungen in Nobels Testament verstoßen?
Emil Bobi konzentriert sich in seiner Studie auf die Frage, ob die bisher praktizierte Vergabe des Friedenspreises gegen die Absichten des Dynamit-Erfinders und Waffenproduzenten gerichtet war, der ja in seinem Testament ausdrücklich bestimmte, diesen Preis an Personen zu verleihen, welche „die meiste oder beste Arbeit für die Verbrüderung von Nationen, für die Abschaffung oder die Reduzierung stehender Armeen und für das Durchführen und Fördern von Friedenskongressen geleistet“ haben.
Die „fast unantastbare heilige Kuh“, wie Bobi sie nennt, konnte er in Oslo schärfer ins Visier nehmen und mit Mitgliedern des Komitees sprechen. Das Nobelkomitee fällt seine Entscheidungen hinter verschlossenen Türen, trägt die Diskussionen über mögliche Preisträger nicht in die Öffentlichkeit und erläutert auch nicht, nach welchen Kriterien es bei ihren Entscheidungen vorgegangen ist.
Die Kandidatenauswahl hat ja viele Beobachter schon seit Jahren irritiert, mitunter aber auch begeistert: Einerseits wurde der pazifistische Publizist Carl von Ossietsky 1935 mit dem Friedenspreis geehrt, was ihn stärken und das Nazi-Regime diskreditieren sollte. Andererseits wurde Mahatma Gandhi mit diesem Preis nie ausgezeichnet: Im Nobel-Gremium kam man nach kontroversen Debatten nämlich offenbar zu dem Schluss, mit so einer Auszeichnung würde man den wichtigen politischen Partner Großbritannien allzu sehr vor den Kopf stoßen – das wollten die Skandinavier nicht riskieren. Was dem Friedenskomitee auch nie einfallen würde, meint Bobi, wäre etwa, den Preis dem US-Whistleblower Edward Snowden für seinen Kampf für demokratische Rechte und gegen die ubiquitäre Bespitzelung zu verleihen, denn in Oslo würde die NATO-Bündnistreue immer noch hohe Priorität besitzen; die USA wolle man nicht mit der Auszeichnung eines „Landesverräters“ provozieren.
Ausweitung der Friedenszone: Preise für Arafat und Mutter Teresa
Die österreichische Spürnase hat Beteiligte aus dem inneren Zirkel des Fünfer-Komitees befragt und den biographischen Hintergrund von Alfred Nobel („Ein depressiver Softie, der niemandem etwas antun konnte“) berücksichtigt, um den Widersprüchen im Leben dieses arbeitswütigen Zerrissenen auf die Spur zu kommen. Der Waffenproduzent und Dynamit-Erfinder war ja lange davon überzeugt, nur mit dem abschreckenden Drohmittel einer monströsen Superwaffe friedensstiftend wirken zu können. Bobi befragte auch den ehemaligen Komitee-Sekretär Geir Lundestad, der bis Ende 2014 im Amt war, ausführlich zu den Entscheidungen der letzten Jahre: Was hätte Alfred Nobel zu dem breiten Spektrum der gewählten Preisträger gesagt? Hat das Komitee gegen Nobels Testamentsverfügung verstoßen? Wie hält es das Komitee mit der Einflußnahme auf politische Prozesse?
Lundestad deutet an, dass er selbst mit etlichen Entscheidungen nicht einverstanden war und etwa Obama für ihn ein inakzeptabler Kandidat war. „Aber kein Friedenspreis hat jemals für so viel Aufmerksamkeit gesorgt wie der2009 für Barack Obama“. Einen Verstoß gegen das Nobel-Testament könne er nicht erkennen: „Ich glaube, Alfred Nobel wäre extrem beeindruckt, dass seine Preise so universell anerkannt sind“. Man müsse heutzutage, wo sich alle Erkenntnisprozesse, Hierarchien und Wissenschaftsdisziplinen vermischen und ändern, den Friedensbegriff weiter interpretieren – nicht nur als Abwesenheit von Krieg. Die Bandbreite der Preisträger, die von Arafat bis zu Mutter Teresa reiche, würde ja für sich sprechen. Auch Nobel hätte nicht nur die Abrüstung als einzigen Weg zum Frieden im Visier gehabt: „Warum hat er denn sonst an Waffen gearbeitet und Waffenfabriken gekauft, wenn er das geglaubt hätte“? Man müsse auch die Parameter berücksichtigen, die für friedliche Lebensbedingungen entscheidend sind. Und dazu gehöre auch die Umwelt, das Problem der Klimaerwärmung usw. Selbst den völkerverbindenden Fußball, Olympia und sogar den Tierschutz könnte man bei der Preisvergabe berücksichtigen, erklärt er dem Österreicher. Gegen die Interventionen von norwegischen Politikern, die sich in die Preisvergabe einmischten, habe es aber erheblichen Widerstand gegeben – als man dem chinesischen Dissidenten Liu Xiaobo den Preis verlieh, gab es Proteste des norwegischen Außenministers Jonas Gahr Store, die man einfach ignoriert habe.
Zum Preisverleihungsprozedere stellt Lundestad auch klar, dass das Komitee keine Kandidaten nominiert, sondern weltweit bei Uni-Professoren, Parlamentsabgeordneten, Nobelpreisträgern, Staatsmännern und Experten von Fachinstitutionen Vorschläge für eine Nominierung einholt. Die vielen Namen auf der Liste – für 2015 waren es 273 – werden dann auf eine Shortlist mit fünf Namen eingedampft und der Kandidat für den Friedensnobelpreis im Oktober bekannt gegeben.
Inzwischen hat der Geschichtswissenschaftler Geir Lundestad, der ja 25 Jahre lang als Komiteesekretär tätig war, im September seine Memoiren („Der Friedenssekretär“ –noch nicht übersetzt) veröffentlicht, die in Norwegen für Furore sorgten und ihm beim Establishment das „Nestbeschmutzer“-Etikett einbrachten. Da er nun aus dem Nähkästchen plauderte und die Verpflichtung zur absoluten Verschwiegenheit über die Komitee-Interna verstieß, ist die Aufregung groß. Aber seine Kritik an der Zusammensetzung des Komitees ist ebenso berechtigt wie seine Sorge vor zu massiven Interventionen von Politikern. Es könne doch nicht sein, meint Lundestad, dass norwegische Provinzpolitiker oder Abgeordnete ins Komitee gewählt werden, die kaum Fremdsprachenkenntnisse hätten oder von den meisten Kandidaten noch nie den Namen gehört hätten. Die größte Provokation für viele Norweger schien jedoch die radikale Kritik am Ex-Kollegen Thorbjörn Jagland zu sein: Der norwegische Ex-Premier hat als Komitee-Mitglied laut Lundestad vor den Preisverleihungen gegenüber Journalisten Andeutungen über die jeweiligen Chancen diverser Kandidaten gemacht und sich immer darauf verlassen, dass Lundestad ihm als Ghostwriter zur Seite stand. Von übler Verleumdung ist die Rede; aus dem friedensbewegten Komitee ist plötzlich ein ziemlich skandalbewegtes Tollhaus geworden.
Vielleicht kann das tunesische Dialog-Quartett, das im Dezember mit dem Friedenspreis ausgezeichnet wird, ja beschwichtigend-friedensstiftend eingreifen?
Emil Bobi hat jedenfalls eine aufregende, akribisch recherchierte, scharfsinnige Studie über die Geschichte und die internen Probleme des Friedenspreis-Komitees geliefert – das hohe „Kulturgericht“ im Norden verliert so den Nimbus der Unantastbarkeit und nimmt hoffentlich Fahrt auf bei den bevorstehenden Reformschritten.
Peter Münder
Emil Bobi: Der Friedensnobelpreis. Ecowin Verlag, Wals bei Salzburg 2015. 192 Seiten. 18,95 Euro. eBook 14, 99 Euro
Engl. eBook: The Nobel Peace Prize. The Truth Behind The Honor. 9,99 Euro.











