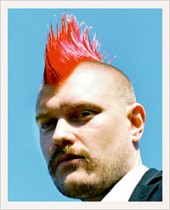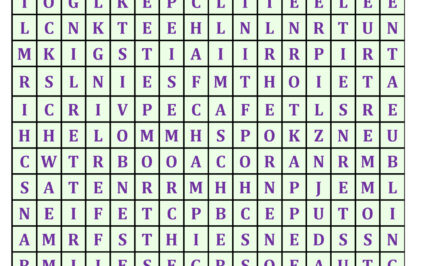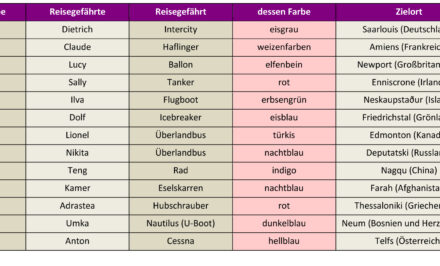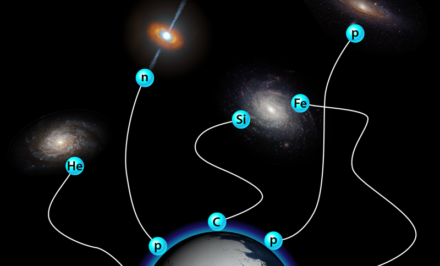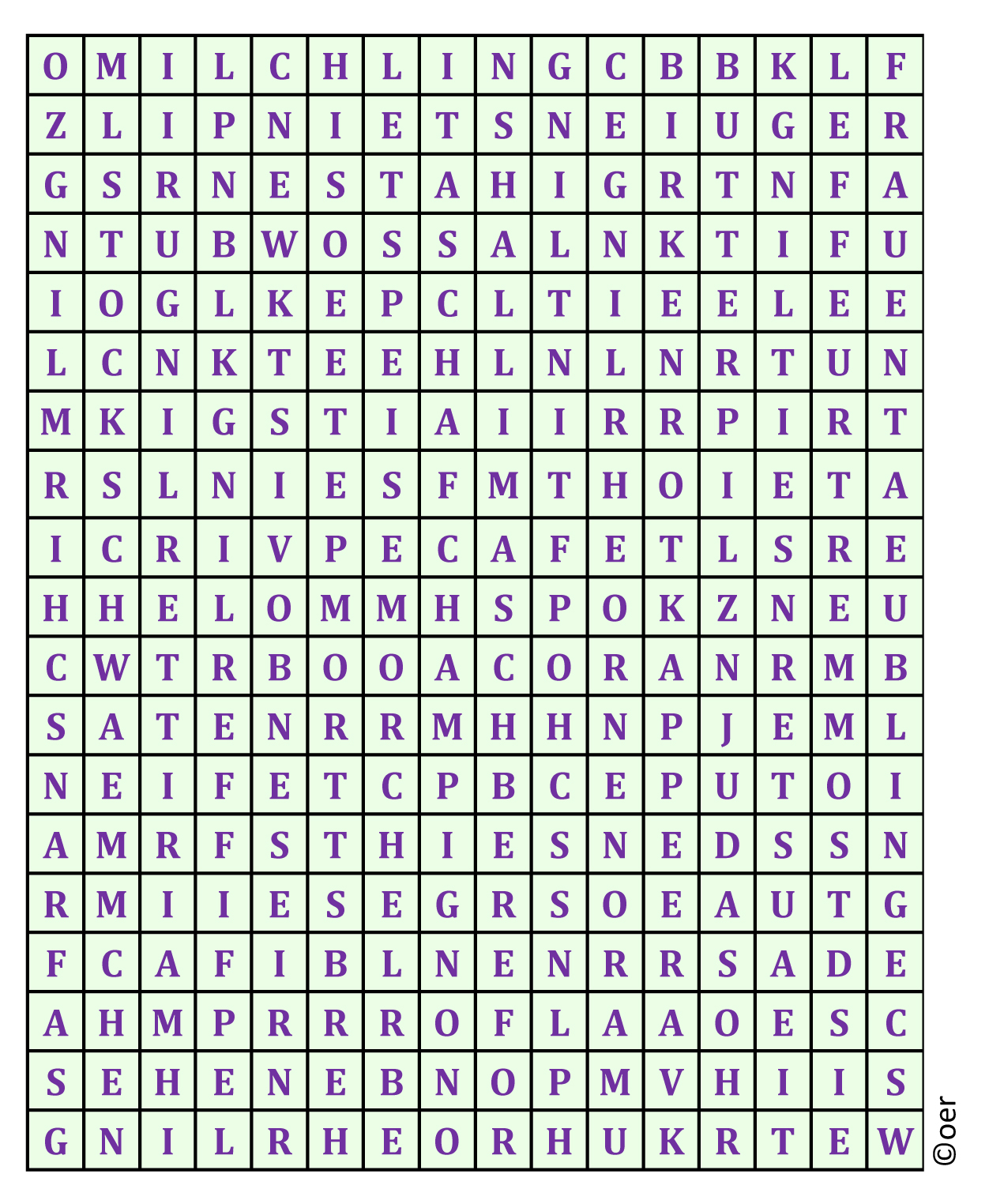Kein Feuer
Kein Feuer
– Was soll man da noch sagen, ist nicht schon alles zu diesem Buch gesagt worden? Vielleicht. Aber probieren wir es heute ausnahmsweise auch mal mit etwas mehr Abstand. Von Henrike Heiland
Erst mal das Offensichtliche, was auch schon oft gesagt wurde: das Cover. Der Autor ist drauf, also seine Haare, und wer mit ihm vertwittert oder verfacebookt ist, erkennt das Bild sofort. Ja, von wegen verkaufsfördernd und so weiter. Hat zur Folge, dass man bei der Hauptfigur wenigstens bis zur Hälfte des Buches immer zusammenzuckt und denkt: Wieso heißt der jetzt Stefan, der heißt doch Sascha, ach nee, ist ja ein Roman. Und ja, man kann nicht anders als darüber spekulieren, wie viel Sascha in Stefan steckt, hoffentlich weniger als gemeinhin angenommen. Aber wenn das Ding als Schlüsselroman in die Buchläden geworfen wird, wer ist dann wer in echt? Hm. Ignorieren wir das einfach, weil es vielleicht doch gar kein Schlüsselroman ist. Obwohl der Autor auf dem Cover ist und Schlüsselroman draufsteht. Nein, wir ignorieren es, wir wollten mit Abstand rangehen.
Die Story also, weil man soll ja das Buch nicht nach dem Cover usw. Die Story ist, wurde schon vielfach betont, flach, vorhersehbar, ohne Erkenntnisgewinn, zehn Jahre zu spät. Eine Sammlung netter Anekdoten aus der Werberwelt, aber irgendwie wird man das Gefühl nicht los, alles schon mal irgendwo gesehen, gehört, gelesen zu haben, und manch eine Szene liest sich wie ein zu oft erzählter Witz, der schon beim ersten Mal nur durchschnittlich witzig war.
Nett ist ein Todesurteil
Ach so, für die, die nicht wissen, worum es geht: Stefan, superschlauer Typ, der auch die Frauenwelt zu beeindrucken weiß (auf den ersten Seiten gleich schon mal Sex mit zwei Frauen gleichzeitig, Silvesterparty und so), will mit seinem Kumpel Thorsten das große Ding machen: Sie gründen eine Agentur, verarschen die Kunden, verheizen sich und ihre Mitarbeiter, und am Ende platzt die Agentur-Blase, weil die dotcom-Blase platzt. Stefan kann übrigens ganz toll Gesichter lesen, fast schon so gut, als könnte er Gedanken lesen. In den entscheidenden Augenblicken passt er nur leider gerade kurz nicht auf. Stefan hat ansonsten auch noch eine Freundin, Lena, ein Mädchen, das er dringend haben wollte. Er betrügt und belügt sie, man hat keine Ahnung, was er an ihr findet, außer, dass sie süß ist, und man hat noch weniger Ahnung, was sie an ihm findet, denn Stefan scheint nicht mal besonders süß zu sein, und äh mehr ist da jetzt auch nicht zu sagen. Das ist wohl das Hauptproblem des Buches, es vermag einen nicht zu packen. Die Charaktere bleiben nicht hängen, die Story ist nicht eindringlich genug, die Geschichtchen sind teilweise nett, aber bitte, was bedeutet schon nett, nett ist ein Todesurteil.
An der Sprache wurde sich ebenfalls oft aufgehängt. Die allerdings passt. Die ist so auf den Ich-Erzähler draufgemeißelt, die muss so. Wenn etwas diesen Stefan charakterisiert, dann ja wohl diese Sprache. Viel mehr gibt’s ja auch leider nicht, was Stefan charakterisieren könnte.
Schelmenroman ohne Schelm
Aber wir wollten ja versuchen, das Werk ohne Sascha Lobo und so weiter zu betrachten. Also gut: „Strohfeuer“ ist in seiner Struktur und Anlage ein Schelmenroman, Stefan entsprechend ein Hochstapler, der sich so durchlaviert. Leider funktioniert dieser Schelmenroman nicht. Weil Stefan nichts passiert. Er ist nie wirklich emotional involviert, es steht für ihn nie wirklich etwas auf dem Spiel, er verkauft nie wirklich seine Seele an den Teufel, hat kein wirkliches Ziel und riskiert nie wirklich etwas. Wenn er auf der Autobahn bei Tempo irgendwas über 200 die Augen schließt, kommt er nicht mal ins Schleudern. Wenn er seine Freundin betrügt, wird er nicht mal richtig erwischt. Er lernt nichts aus dem, was geschieht, nicht mal für einen kleinen Moment. So jemanden nennt man im Englischen einen flat character, so jemand eignet sich zur Neben-, nicht zur Hauptfigur, weil man über ihn kaum etwas erfährt, weil er sich nicht entwickelt, weil er nur eine Randfunktion füllt, um die Handlung weiterzubringen, aber es ist nicht seine Geschichte, die erzählt wird, normalerweise, nur eben in „Strohfeuer“ soll es seine Geschichte sein, und das haut nicht hin. Die Murmelepisoden aus Stefans Vergangenheit helfen da auch nicht weiter. Ein guter Schelm, oder Hochstapler, braucht mehr Fleisch, mehr Fallhöhe, mehr Risiko und mehr Gefühl. Felix Krull ist ein guter Schelm, den könnte man sich mal wieder als Lektüre vornehmen.
Und was ist mit dem Zeitgefühl, mit dem Abbilden der Lebenswirklichkeit einer Generation? Funktioniert auch nicht. Irgendwie schafft es die Geschichte nicht hinaus über „Da sind so ein paar Idioten, die machen irgendeinen Scheiß, und klapp ist das Buch zu Ende“. Es bleibt Nabelschau des Ich-Erzählers, was kratzt das die anderen.
Man ist versucht, die ganze Zeit mit Joshua Ferris’ „Then We Came to the End“ zu winken und zu sagen, hey, da waren Ideen drin, Textideen, Inhaltsideen, da gab es mehr als nur eine Ebene, da gab es nicht nur ein paar amüsante Sätze, die sich als Tweet oder im Blog besonders gut gelesen haben und deshalb jetzt im Roman stehen, und, ja, Vergleiche sind blöd, aber dieser drängt sich nun mal auf, genau wie Thomas Manns „Felix Krull“. Schade. Ist ja nicht so, als hätte das Ding kein Potential, auch wenn es vielleicht ein paar Jahre zu spät kommt. Eine gute Geschichte darf ein paar Jahre zu spät sein. Aber dann muss sie eben auch gut erzählt werden. Jetzt wieder weg vom Buch und hin zum Autor, da stellt sich die Frage: Schafft er einen zweiten Roman? Jeder hat schließlich eine Geschichte in sich, nämlich die eigene. Spannend wird es beim zweiten Roman, ob man sich wiederholt, von sich selbst abschreibt, oder ob man wirklich Ideen und Abstand zum eigenen Saft hat, in dem man schmort, und ob man plotten kann und Charaktere und Perspektiven entwickeln und zum Handwerk findet. Abwarten.
Henrike Heiland
Sascha Lobo: Strohfeuer. Roman. Berlin: Rowohlt Verlag 2010. 288 Seiten. 18,95 Euro. Zum Blog von Sascha Lobo.