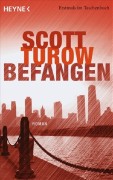 Kapriziöse Göttin Justitia
Kapriziöse Göttin Justitia
Auch dieser Justizroman bezieht seine wirkliche Spannung nicht so sehr aus der Eloquenz und dem Charisma eines Verteidigers, sondern aus einem philosophischen Problem: Der Differenz von Recht und Gerechtigkeit. Von Hans Richard Brittnacher
Das trotz des unermüdlichen Erle Stanley Gardner und seines hemdsärmeligen Perry Mason schließlich doch arg in die Jahre gekommene Genre des Justizkrimis ist irgendwann in den 60er-Jahren des letzten Jahrhunderts friedlich entschlafen. Vermisst wurde es kaum – denn die Vorstellung vom eloquenten Anwalt, der aus purem Gerechtigkeitssinn und auch noch ohne Bezahlung die Verteidigung eines Angeklagten übernimmt, gegen den alle Indizien sprechen, und dann beim Kreuzverhör den Hauptbelastungszeugen der Anklage dermaßen in Bedrängnis bringt, dass dieser schließlich die Tat gesteht, hat doch allzu sehr die Glaubwürdigkeit strapaziert, die beim Krimi, mehr als in anderen Spielarten der Literatur, ihr Recht verlangt.
Zu neuem Leben galvanisiert wurde der Justizkrimi dann wieder durch Beiträge aus Amerika – insbesondere den Romanen von John Grisham und Scott Turow ist es gelungen, aus dem Thema Justiz neue Funken zu schlagen und dem Tatort Gerichtssaal zu neuer Attraktivität zu verhelfen. Dabei könnten die beiden Autoren unterschiedlicher kaum sein: Grisham ist mit seinen Fabeln vom juristischen Underdog, der die geballte Macht des amerikanischen Behördenapparats ausstrickst, so etwas wie der Manta unter den neueren Justikrimis, während Scott Turow eher an einen gemächlich dahinfahrenden Volvo mit einer ungleich komplexeren Motorleistung erinnert. In mittlerweile fast zehn Romanen, die alle im fiktiven Kindle County in Illinois spielen, einem Mikrokosmos der amerikanischen Gesellschaft, erzählt der selbst erfolgreich als Jurist tätige Turow seine Kriminalromane als Parabeln auf den Zustand der amerikanischen Gesellschaft. Dass es um ihre moralischen Werte womöglich noch desaströser bestellt ist als um ihre außenpolitischen Perspektiven, wird mit jedem von Turows Romanen deutlicher.
Der Justizroman, zu dessen literarischer Reputation hierzulande Werke wie Ricarda Huchs Der Fall Deruga, Jakob Wassermanns Der Fall Mauritius oder Thomas Hettches Der Fall Arbogast beigetragen haben, bezieht seine wirkliche Spannung übrigens nicht so sehr aus der Eloquenz und dem Charisma eines Verteidigers, sondern aus einem philosophischen Problem: Der Differenz von Recht und Gerechtigkeit. Die Buchstaben des Gesetzes verhelfen einem abstrakten Recht zur Geltung, die Idee der Gerechtigkeit hingegen ist beseelt von der Anteilnahme an der Täterseele und der Einsicht in den Tatvorgang. Sie vermag daher auch mit dem in die Enge getriebenen Amokläufer sympathisieren, der vor dem Auge des Gesetzes keine Gnade findet.
Bizarre juristische Fingerhakelei
Die Göttin Justitia trägt eine Waage in der Hand und eine Binde um die Augen: sie hat gegen alle Privatinteressen unparteiisch und der Idee eines jederzeit gültigen, überzeitlichen Rechts verpflichtet zu sein. Dass diese Göttin aber auch kapriziös sein kann, dass sie heute bestraft, was sie gestern noch geduldet hat, beschert Turows neuem, zuerst in Fortsetzungen im New York Times Magazine erschienenen Roman, seinen rechtsphilosophischen Kern. Denn Richter Mason steht vor einem Konflikt, der juristisch so knifflig wie menschlich verstörend ist. Es geht um einen gang bang, eine Massenvergewaltigung: An einer gemilderten Variante dieses Verbrechens zu einer Zeit sexueller Liberalisierung hat der Richter, wie er sich schweren Herzens eingestehen muss, selbst teilgenommen; heute, fast vierzig Jahre später, hat er über einen besonders scheußlichen Fall dieses Delikts zu entscheiden – zu einem Zeitpunkt, als es endlich in den Rang eines Straftatbestands aufgerückt ist. Doch gibt sich Turow mit der persönlichen Komplizierung einer juristischen Frage nicht zufrieden, er führt den Fall zudem als bizarre juristische Fingerhakelei vor, in dem die Kategorien von Recht und Falsch in ihrer fast bodenlosen Ambivalenz sichtbar werden. Denn Mason hat nicht die Vergewaltiger zu verurteilen, sondern über ihren Antrag auf Aufhebung des bereits verhängten Urteilsspruchs zu befinden. Das Urteil wurde seinerzeit aufgrund einer Videoaufzeichnung der Vergewaltigung gefällt, die freilich ohne Einwilligung des Opfers zustande kam.
Zu den besonderen Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung Amerikas, erbittert gegen die beständige staatliche Überwachung durchgesetzt, zählt die Abweisung unzulässig erlangten Beweismaterials. Soll also die aufgrund der unzulässig angefertigten Videoaufzeichnung eines Verbrechens erfolgte Verurteilung der zweifelsfrei schuldigen Angeklagten wegen eines rechtlichen Vorbehalts, der eigentlich zum Schutz der Schwachen gedacht war, aufgehoben werden? Zudem wurde das Videoband erst gefunden, als bereits die Verjährungsfrist für das Verbrechen der Vergewaltigung abgelaufen war. Komplizierten Aufgaben, denen sich Richter Mason gegenübersteht und die er, konfrontiert mit seinem eigenen menschlichen Versagen, zu bewältigen hat, während er selbst gleichzeitig Opfer anonymer Todesdrohungen ist, seine krebskranke Frau eine Chemotherapie zu überstehen hat und seine opportunistischen Kollegen ihn im Stich lassen. Nur Rusty Sabich, dem Leser vielleicht noch aus Turows wohl bekanntestem Roman Aus Mangel an Beweisen in Erinnerung, steht Mason in seinem Mehrfrontenkrieg bei.
Masons salomonische Entscheidung des Urteils und seine Entlarvung des Todesbriefsenders fallen überzeugend, wenn auch etwas langatmig aus. Mit seiner Bereitschaft, einen Roman in Fortsetzungen für die New York Times zu schreiben, hat Turow das mäandrierende, umwegige und öfter mal Atem holende Genre des Justizkrimis an die hektisch auf Abbruch und Weiterführung drängende Dramaturgie des Kolportageromans verraten und dabei seinem Text immer wieder Adrenalinstöße verordnen müssen, die dann nicht eingehalten werden können. Die aus der tiefsten Asservatenkammer des Kriminalromans hervorgekramte Verpflichtung, in einem ausführlichen Gespräch am Ende des Romans alle Details der Intrige rückblickend aufzuklären, trägt zur detektivischen Geschlossenheit des Plots, nicht aber zu seiner attraktiven literarischen Darbietung bei.
Turow kann’s besser – aber auch so immer noch gut genug, um die meisten Justizkrimis mit ihren gerissenen Anwälten und vertrottelten Staatsanwälten zu deklassieren.
Hans Richard Brittnacher
Scott Turow: Befangen (Limitations, 2006) Roman. Dt. von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Blessing 2008. 303 Seiten . 16,95 Euro.











