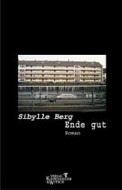 Weltschmerzszenario
Weltschmerzszenario
Sibylle Berg ist penetrant. Auf über dreihundert Seiten trägt sie haufenweise Material zusammen, um den Verfall der Welt zu dokumentieren. Doch wozu? Die Geschichte ihrer Heldin geht dabei unter, der Leser bleibt außen vor. Wer trotzdem dran bleibt, kann immerhin ihr ausführlich entfaltetes, apokalyptisches Zukunftspanorama erkunden. Von Markus Kuhn
Ende gut – Wer Sibylle Berg kennt, der ahnt nichts Gutes, wenn er diesen Titel liest. Ein gutes Ende, vielleicht sogar ein versöhnliches Happyend à la Hollywood, das kann sie nur ironisch meinen. Und tatsächlich: Vom ersten Satz an ergießt sich eine weibliche Ich-Erzählerin „so um die 40“ über die Widrigkeiten ihres Seins, ihre Unlust weiterzuleben, die Sinnlosigkeit allen Tuns und die Schlechtigkeit der Welt. Jede noch so perfide Form eines Happyends kann da nur ein weiterer sarkastischer Stich gegen die letzten Spuren eines absurden Optimismus sein.
Verfall und nochmals Verfall
Das meiste, was Sibylle Berg in Ende gut zusammenträgt, um den Verfall der Weltgemeinschaft zu dokumentieren, meint man schon einmal gelesen zu haben – und zwar bei ihr. Sibylle Berg kopiert sich selbst. Neu ist nur, dass sie ihre Hasstirade gegen das menschliche Sein mit den großen Themen des 21. Jahrhunderts anreichert: Terrorismus, George Bushs Hegemonialpolititk, Präventivkriege, biologische Waffen, islamische Fundamentalisten, Naturkatastrophen usw. Ende gut spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft: „Seit sich Deutschlands Politiker in der Hoffnung auf eine Wiederwahl gegen eine Unterstützung des Irak-Kriegs sowie die Invasionen in Nordkorea und den Jemen entschieden haben, sind die Beziehungen zu den USA zum Erliegen gekommen.“ Ein Handelsembargo seitens der USA hat die deutsche Wirtschaft nahezu ruiniert, es gibt zwölf Millionen Arbeitslose „und auch der neuen rechts-konservativen Regierung ist es nicht gelungen, irgend etwas daran zu ändern.“
Doch Arbeitslosigkeit ist nicht mehr das Hauptproblem. Während die Niederlande mit der Erhöhung des Meeresspiegels zu kämpfen haben, wird Deutschland von Seuchen und Terroranschlägen heimgesucht. „SARS und Aids sind eindeutig als Attentate identifiziert, und es hat bereits eine neue Seuche, irgendwas mit Hautausschlag und Sterben.“ Die Erzählerin sammelt apokalyptische Informationen, um sie im selben Atemzug zu verdrängen oder mit einer dicken Schicht Zynismus zuzukleistern. „Bereits vor der Geburt werden die Menschen zurechtgebaut in einem Gen-Baukasten. Ich habe nichts dagegen, denn wenn man sieht, was aus frei laufenden Genen entsteht, kann man diese Entwicklung nur begrüßen.“
Stummer Frieden
Erst als die Erzählerin dem Selbstmord einer dicken Frau zuschaut – „Die Frau will sterben, und es fällt mir kein Grund ein, warum sie weiterleben sollte. Wirklich keiner.“ –, beschließt sie, ihr bisheriges Leben zu ändern. Auf einer absurden Reise von einem Katastrophengebiet ins nächste, die bald zur Flucht vor Anti-Seuchen-Kommandos und militärischen Sicherheitsdiensten gerät, gelangt sie über Hamburg, Berlin, Weimar und Amsterdam nach Finnland, wo sie auf einer kleinen Insel mit einem stummen Mann, den sie nicht liebt, aber erträgt, ihren Frieden findet.
Das größte Manko des Textes ist, dass man diese Geschichte auf keiner Ebene ernst nehmen kann. Zum einen, weil sie ebenso übertrieben ist, wie das gesamte Endzeit-Panorama, das Sibylle Berg entfaltet, zum anderen weil sie von einer enormen Materialfülle verschüttet wird. Weniger wäre mehr gewesen, denn der Leser bleibt außen vor und muss sich durch ein über 300-seitiges Weltschmerzgestöhne ohne nennenswerte Spannungsbögen kämpfen. Das stumpft genauso ab, wie die sich ständig wiederholenden Katastrophenbilder im Fernsehen, die die Erzählerin kritisiert. Dass der Text sich selbst und das Leiden der Heldin nicht immer ernst nimmt, unterstützt die Unglaubwürdigkeit.
Dabei lässt sich Sibylle Berg einiges einfallen. So mischen sich die Stimmen unzähliger Randfiguren zwischen die Erzählung und erklären, warum sie gescheitert sind oder scheitern werden, so fehlt ihrem üblichen düster-lakonischen Stil auch nicht seine ebenso übliche bissige Ironie. Zwischendurch gibt es immer wieder Perlen Berg’scher Erzählkunst, die ihre Gesellschaftskritik eiskalt auf den Punkt bringen.
Doch trotz des enormen Aufwands, den die Autorin betrieben hat, trotz des ausführlich erörterten pessimistischen Gesellschaftsbilds entwickelt der Roman keinen so schockierenden und mitreißenden Sog wie ihr Erstling Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot, Amerika oder einige Erzählungen. Dort hat sie gezielt gebündelt, was sie hier seitenweise breit tritt. Wie die Erzählerin stört den Leser bald überhaupt nichts mehr – frei nach dem Motto: Stell dir vor, die Welt geht unter und keiner schaut zu.
Markus Kuhn
Sibylle Berg: Ende gut. Kiepenheuer & Witsch Verlag, Februar 2004, 335 Seiten, 19,90
05.04.2004











