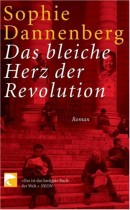 Children of the Revolution
Children of the Revolution
Wenn sich Jungautoren literarisch mit den Umbrüchen von 68 befassen, begeben sie sich auf sehr dünnes Eis – Sophie Dannenberg versucht es mit einem satirischen Blick, hinter dem der bittere Ernst lauert.
Schon Leander Scholz („Rosenfest“) wurde vom Feuilleton vorgeworfen, nicht berufen zu sein, um Baader und Ensslin zu Romanfiguren zu machen. Die 1971 geborene Sophie Dannenberg geht mit ihrem Debüt „Das bleiche Herz der Revolution“ ein ähnliches Risiko ein, wenn sie zwar die Lebensgeschichte eines Kindes der 68er Generation schildert, sich aber in einer Parallelgeschichte in tiefste akademische Intrigen an der Frankfurter Uni wagt.
„68 ist das Kind von 45“ behauptet Dannenberg und so ist es nur konsequent, dass sie den Bogen für ihre 68er-Abrechnung vom zerbombten München bis in die Gegenwart spannt. Doch im Zentrum des Romans liegt eindeutig das Deutschland der 68er. Eine von Dannenbergs Hauptfiguren ist Hieronymus Arber, vielversprechender Assistent von Professor Dr. Aaron Wisent, Direktor des Frankfurter Instituts. Als sich Wisent weigert, einem Flugblatt der Kommune 1, das strafrechtliche Konsequenzen nach sich zu ziehen droht, mit einem positiven Gutachten wissenschaftlichen Segen zu erteilen, gerät er in die Schusslinie studentischen Zorns. Die Proteste gegen Wisent eskalieren in einem Tumult, in dessen Verlauf ein Molotow-Cocktail den Professor tötet. Arber, der bis dahin als sicherer Nachfolger Wisents gehandelt wurde, wird Opfer ganz und gar unsozialistischer Intrigen. Das Ende seiner Karriere besiegelt allerdings seine recht einseitige Liebe zur Studentin Birgitta, die ihn nach Herzenslust manipuliert. Viele Jahre später macht er in einer denkwürdigen Ausstellung auf sehr unkonventionelle Art – er fällt in ein Becken mit Fäkalien – die Bekanntschaft der Galeristin Kitty Caspari. Während seine Wäsche gereinigt wird, kommen die beiden ins Gespräch. „Waren Sie ein Kursbuch-17-Kind?“ fragt er, „Eins dieser antiautoritär verwahrlosten?“ – „War ich“, entgegnet Kitty – und was das bedeuten kann, erläutert ihre nachfolgende, in Ich-Form geschriebene, Kindheitsgeschichte.
Theorie der Revolution
Als Tochter eines Anwaltes, der sich Kriegsdienstverweigerern und RAF-Terroristen annahm (den Namen „von Baguette“ hätte sich Dannenberg allerdings ebenso verkneifen können wie das mäßig komische Adorno-Wiesent-Spielchen) und einer Stadtplanerin, die davon träumte, einen integrativen Wohnkomplex zu entwerfen, wird Kitty in ein Umfeld hineingeboren, das finanziell sorgenfrei, aber dennoch – oder gerade deshalb – den sozialistischen Theorien sehr zugewandt ist. Ihr Bruder heißt Benno nach Benno Ohnesorg, auf der Lieblingshörspielplatte vom Auto Blubberbumm kommt es zum fröhlich besungenen Aufstand der Arbeiter gegen den Fabrikbesitzer, auf den Möbeln lachen rote Sonnen, die mit emporgereckten Fäusten der nebenan aufgeklebten Friedenstaube ein „Atomkraft Nein Danke!“ entgegenschleudern, im Stück des Grips-Theaters unterhalten sich die Kinder „plötzlich über Pimmel und Mösen“. In ihrer ideologischen Verbohrtheit finden die Eltern keine Zeit, sich der Probleme ihrer Kinder anzunehmen. Dabei ist das revolutionäre Potential der Eltern vorwiegend aufs Theoretisieren beschränkt: Der rote Ballon der DKP darf nur in der Wohnung Farbe bekennen, da die Angst vor dem Berufsverbot umgeht; die ambitionierte Stadtplanerin findet sich mehr und mehr in einer traditionellen Hausmütterchen-Rolle wieder, als man einen Bauernhof im Wendland bezieht, der schneller mit dem Graffiti „Atomwaffenfreie Zone“ versehen ist als mit dichten Fenstern.
Humorlose Weltverbesserer
Sophie Dannenberg, deren Name ein Pseudonym sein soll, karikiert, übertreibt und zieht ins Lächerliche – doch aller satirische Ansatz täuscht nicht darüber hinweg, dass es sich bei dem Roman um eine ernstzunehmende Anklage handelt. Am Entlarvendsten und Erschreckendsten sind nicht zuletzt die Originalzitate, die Dannenberg in den Roman einstreut. Sie stellt die Aktivisten der 68er bloß als verbissene und humorlose Kämpfer für ein besseres Leben, das sie selbst vor lauter schlechtem Gewissen nicht zu leben wagen. Die Kinder werden den Idealen bedenkenlos geopfert: Die nahezu zwanghafte sexuelle Freizügigkeit überschreitet schnell Grenzen, die in unseren hierfür besonders sensiblen Zeiten die Schwelle zum Kindesmissbrauch markieren – wenn etwa die Kinder aufgefordert werden, den Eltern beim Sex zuzusehen oder aber die Sitzungen bei einer selbsternannten Psychotherapeutin, in der Kitty mit der Anschuldigung konfrontiert wird, durch ihre „ödipal-regressiv-aggressiv-inzestuös-anale“ Abhängigkeit für alle Probleme zwischen ihren Eltern verantwortlich zu sein. Der Leser möchte lachen aufgrund der offensichtlich absurden Situationen und Gespräche – und gleichzeitig ahnt man, dass – in gewissen Abstufungen – solche Situationen für manche Kinder bittere Realität gewesen sein dürften. Dabei macht es sich Dannenberg nicht so leicht, die Eltern schlicht als Täter darzustellen, nein, sie sind selbst Opfer ihrer eigenen Lebensziele. Entlarvend blickt sie auf die Menschen, die zur Vereinigung der Proletarier aller Länder aufrufen, ohne in ihren universitären Elfenbeintürmen jemals mit Arbeitern in Berührung gekommen zu sein – und am Ende haben sich gerade die Revoluzzer, die Wisent stürzten, in das sichere Netz des universitären öffentlichen Dienstes fallen lassen.
Sophie Dannenbergs Roman sollte möglichst nicht als Schlüsselroman gelesen werden, vielmehr als herrlich überdrehte Satire Denkanstöße zu einer Zeit geben, die nur allzu gern in den Nebeln der Erinnerung verklärt wird.
Frank Schorneck
Sophie Dannenberg: Das bleiche Herz der Revolution. DVA 2004. Gebunden, 393 Seiten, 19,90 Euro. ISBN: 3-421-05830-X











